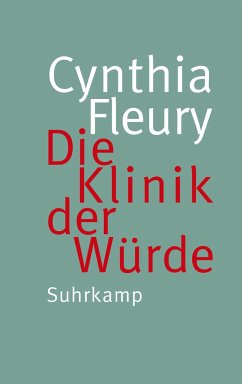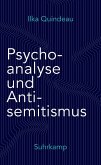Der Imperativ der Würde steht heute im Zentrum zahlreicher sozialer Bewegungen und gesellschaftlicher Debatten über Diskriminierung, Arbeit oder sogar Tierhaltung. Gleichzeitig haben sich jedoch Verletzungen der Würde und Erfahrungen der Würdelosigkeit vervielfacht: in Krankenhäusern und Pflegeheimen zum Beispiel oder in Flüchtlingslagern und Gefängnissen. Das Versprechen der Würde, das die Moderne stolz verkündete, scheint wiederholt verraten worden zu sein, wie die französische Philosophin und Psychoanalytikerin Cynthia Fleury in ihrem neuen Buch zeigt.
Sie plädiert für eine psychoanalytische Klinik der Würde, um eine philosophische Diagnose stellen und therapeutische Lösungen finden zu können. Unter Berufung auf die Schriften von James Baldwin, auf Theorien der Sorge und postkoloniale Ansätze fordert sie dazu auf, sich nicht mit Untätigkeit abzufinden und das Konzept der Würde von seinen Rändern her neu zu denken. Im Zusammenspiel von Psychoanalyse, Literatur und Sozialwissenschaft gewinnt die Forderung nach Würde im Zeitalter des Anthropozäns so ihre ganze Radikalität zurück.
Sie plädiert für eine psychoanalytische Klinik der Würde, um eine philosophische Diagnose stellen und therapeutische Lösungen finden zu können. Unter Berufung auf die Schriften von James Baldwin, auf Theorien der Sorge und postkoloniale Ansätze fordert sie dazu auf, sich nicht mit Untätigkeit abzufinden und das Konzept der Würde von seinen Rändern her neu zu denken. Im Zusammenspiel von Psychoanalyse, Literatur und Sozialwissenschaft gewinnt die Forderung nach Würde im Zeitalter des Anthropozäns so ihre ganze Radikalität zurück.