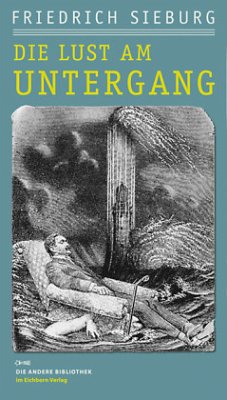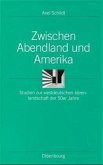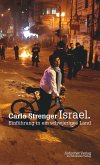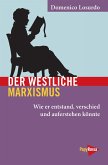Die chronische Sehnsucht nach der Apokalypse_Wir Deutsche malen am liebsten schwarz. Wenn uns im Augenblick keine Katastrophe heimsucht, dann sehen wir eine kommen. Wir können, so scheint es, ohne die apokalyptischen Ängste nicht existieren. Niemand durchschaute die dunklen Süchte unserer Seele genauer als der große Zeitkritiker Friedrich Sieburg, einer der brillantesten Stilisten seiner Epoche. Seine Bücher wurden zu Hunderttausenden verkauft. Doch in Deutschland steht sein Werk - anders als in Frankreich - unbeachtet im Schrank. Er war kein Mann der politischen Eindeutigkeit und schon gar nicht des Widerstandes gegen den Nazismus. Und dennoch - oder darum - ist er einer der wichtigsten Zeitgenossen jener Epoche, die er in seiner grandiosen Polemik von 1954 Revue passieren lässt.
" ... schön gestaltetes Buch, dem Thea Dorn schwungvolle, dazu blitzgescheite Erläuterungen beigegeben hat ... "(Tilman Krause, Die Welt, 26. Juni 2010)
" ... ein zu Unrecht fast vergessenes Buch. Eine Wiederentdeckung."(Passauer Neue Presse, 3. Juli 2010)
"Sieburgs Buch ist wiederaufgetaucht wie ein altes Möbelstück, das vor Jahrzehnten sorgsam in weiße Tücher gehüllt und dann in abgedunkelten Räumen vergessen wurde. Nun zieht diese Neuausgabe der Lust am Untergang die alten Laken herunter, und wenn der aufgewirbelte Staub sich gelegt hat, steht man da und wundert sich. Bequem sieht das nicht aus, und es passt weiß Gott nicht zu jeder Einrichtung. Aber man ahnt, man wird sich so rasch nicht wieder davon trennen können."(Hubert Spiegel, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 3. Juli 2010)
" ... ein zu Unrecht fast vergessenes Buch. Eine Wiederentdeckung."(Passauer Neue Presse, 3. Juli 2010)
"Sieburgs Buch ist wiederaufgetaucht wie ein altes Möbelstück, das vor Jahrzehnten sorgsam in weiße Tücher gehüllt und dann in abgedunkelten Räumen vergessen wurde. Nun zieht diese Neuausgabe der Lust am Untergang die alten Laken herunter, und wenn der aufgewirbelte Staub sich gelegt hat, steht man da und wundert sich. Bequem sieht das nicht aus, und es passt weiß Gott nicht zu jeder Einrichtung. Aber man ahnt, man wird sich so rasch nicht wieder davon trennen können."(Hubert Spiegel, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 3. Juli 2010)