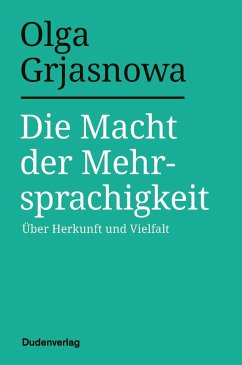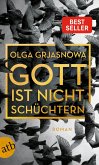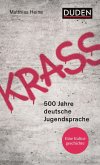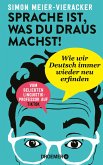Mehrsprachigkeit ist, wie die Schriftstellerin Olga Grjasnowa zeigt, ein Phänomen mit erstaunlich vielen Facetten. Oft gilt sie nur als Kennzeichen guter oder gar elitärer Bildung, dabei ist sie für immer mehr Menschen und Familien hierzulande eine Selbstverständlichkeit. In jedem Fall handelt es sich um eine Fähigkeit, die etwas über die individuellen Biografien wie auch über die sich wandelnde Gesellschaft insgesamt erzählt. Wie ist es, zwischen zwei oder sogar drei Sprachen hin und her wechseln zu können? Warum wird Französisch als Zweitsprache mehr geachtet als Türkisch? Sollte Mehrsprachigkeit nicht generell viel mehr Wertschätzung erfahren und gezielt gefördert werden? Und sorgen die immer leistungsstärkeren Übersetzungsapps und Englisch als die neue Lingua franca womöglich dafür, dass wir uns jeweils mit nur noch einer Sprache begnügen? Grjasnowas faszinierender Text ist Ausdruck ihrer Überzeugung, dass Sprache und Identität eng zusammenhängen - und dass jede Sprache einenganz eigenen Zugang zur Welt eröffnet.
Bitte wählen Sie Ihr Anliegen aus.
Rechnungen
Retourenschein anfordern
Bestellstatus
Storno