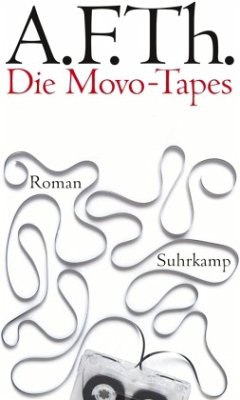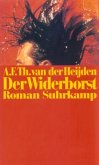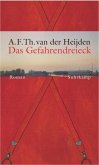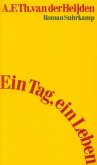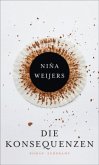"Ich kann mich nicht mal richtig vorstellen, denn ich habe meinen Namen verhökert." Tatsächlich hat der göttliche Apollo bereits Anfang der 1960er, in Geldnöten befindlich, seinen guten Namen an die NASA verkauft - für einen Pappenstiel, so daß der ehemalige Hausherr des Delphi-Orakels künftig vom Horoskopschreiben leben muß. Bei seinen Studien der menschlichen Natur stößt er auf den jungen Niederländer Tibbolt Satink, Jahrgang 1973 und seit seiner Geburt von einem Fußleiden geplagt. Deutet letzteres auf Tibbolt als einen modernen Ödipus? Einen, dem seine leiblichen Eltern fremd sind, einen, der von dem Liebespärchen, das sich 1973 bei Dreharbeiten zu einem Pornofilm kennenlernt, nichts weiß?Tibbolt hat große Pläne; so will er die wüsteste Hooliganschlacht Amsterdams anzetteln, vor allem aber die lästigen Begleiterscheinungen des menschlichen Lebens und Sterbens einem Alter ego mit Namen Movo (niederländisch kurz für "schlimme Füße") aufhalsen. An den Tapes, auf denen Tibbolt von seinem Vorhaben berichtet, ist nicht nur Apollo sehr interessiert.
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Nicht sehr überzeugt hat Rüdiger Nüchtern A.F.Th. van der Heijdens Roman "Die Movo Tapes". Nach dessen über dreitausendfünfhundert Seiten langen Zyklus "Die zahnlose Zeit" folge nun, so der Rezensent, mit der auf acht Bände angelegten Ödipus-Adaption "Homo Duplex" ein weiteres "Prosa-Labyrinth" von monströsen Ausmaßen, eingeleitet durch "Die Movo-Tapes". Der Titel bezieht sich auf die Tonbandkassetten, die die Hauptfigur Tibbolt Satinkt, mutmaßlicher Sohn zweier Porno-Darsteller, auf Spritztouren in seinem Sportwagen bespricht. Laut dem Rezensenten strebt Satinkt danach, sich in "Movo" zu verwandeln (was das genau ist, erklärt der Rezensent leider nicht), um der Endlichkeit ein Schnippchen schlagen. Die fiktive Story ist mit zeitgeschichtlichen Momenten wie der Mondlandung verwoben. Anscheinend, so vermutet er, wolle der Autor mit diesem symbol- und bilderschwangeren Roman gegen die literarische "Kargheit" der niederländischen Literatur protestieren. Herausgekommen sei aber leider eine Fahrt durch ziemlich "zähes Gelände".
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»Der genialische Hochstapler ist tatsächlich ein Meistererzähler.« Richard Kämmerlings Frankfurter Allgemeine Zeitung