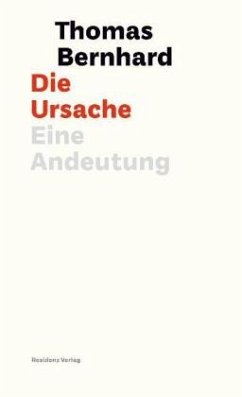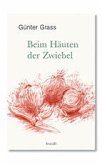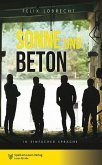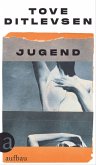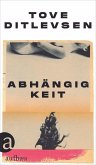In seinen autobiografischen Schriften („Die Ursache“, „Der Keller“, „Der Atem“, „Die Kälte“ und „Ein Kind“) verarbeitete der österreichische Schriftsteller Thomas Bernhard seine Kindheit und Jugend. Diese Erinnerungen spiegeln seine furchtbaren Erlebnisse im nationalsozialistisch und katholisch
geprägten Österreich wider.
Erschütternd und polemisch schildert er die frühen Verletzungen und das…mehrIn seinen autobiografischen Schriften („Die Ursache“, „Der Keller“, „Der Atem“, „Die Kälte“ und „Ein Kind“) verarbeitete der österreichische Schriftsteller Thomas Bernhard seine Kindheit und Jugend. Diese Erinnerungen spiegeln seine furchtbaren Erlebnisse im nationalsozialistisch und katholisch geprägten Österreich wider.
Erschütternd und polemisch schildert er die frühen Verletzungen und das Eingesperrtsein in den verschiedenen Institutionen wie Schule, Internat, Erziehungslager, Krankenhaus und Sanatorium. Wer die Welt von Thomas Bernhard verstehen will, findet hier den Schlüssel. Alle fünf Bände erschienen Ende der 70er bzw. Anfang der 80er Jahre im Residenz Verlag Pölten und liegen nun aus Anlass des 90. Geburtstags von Thomas Bernhard als Taschenbuchausgaben im Deutschen Taschenbuch Verlag vor.
„Die Ursache - Eine Andeutung“ (1975) ist der erste Teil dieser fünfteiligen Autobiografie. Darin erzählt Bernhard von der „Angst- und Schreckensfestung“ seiner Kindheit, dem Salzburger Schülerinternat Johanneum, das er während seines zwölften und fünfzehnten Lebensjahres besuchte. Das zunächst „Nationalsozialistische Schülerheim“ wurde nach dem Krieg notdürftig renoviert und als streng katholisches Staatsgymnasium wieder er-öffnet.
Der junge Bernhard bemerkte jedoch keinen Unterschied bei den Lehrern und ihren Erziehungsmethoden. Die katholische Internatsleitung führte gewissermaßen das nationalsozialistische Erbe fort - die Hitlerbilder wurden gegen Kruzifixe ausgewechselt und die SA-Stiefeln gegen schwarze Stiefeletten der Geistlichkeit ausgetauscht. All das verstärkte Bernhards Abneigung.
Diese Zeit, vom März 1944 bis kurz vor Ende des Krieges und wieder im Schuljahr 1945/46, war für den Jungen geprägt von herzlosen und sadistischen Erziehern. Ideologischer Drill bestimmte den Schulalltag und ließ den internierten Bernhard mit Selbstmordgedanken spielen. Ständig wurde er von seinen Mitschülern und Lehrern, aber vor allem vom Direktor und SA-Offizier Grünkranz gequält und unterdrückt. Dieser wurde zwar nach 1945 von dem Anstaltsgeistlichen „Onkel Franz“ abgelöst, der sich aber ähnlicher Erziehungsmethoden bediente. (Aufgrund der Klage des Salzburger Stadtpfarrers Franz Wesenauer, der sich in dem Buch als „Onkel Franz“ wiederzuerkennen glaubte, und eines Beschlusses des Landgerichts Salzburg aus dem Jahre 1977 mussten Bernhard und der Verlag einige Streichungen vornehmen).
Auch mit Salzburg geht Bernhard hart ins Gericht. Die Mozartstadt charakterisiert er als oberflächlich, die hinter ihrer wunderschönen Fassade erstickt. Über die Einwohner urteilt er gleich im ersten Satz: „Die Stadt ist, von zwei Menschenkategorien bevölkert, von Geschäftemachern und ihren Opfern …“.
Der Text ist in zwei Abschnitte gegliedert, betitelt nach den beiden Internatsleitern: Grün-kranz und Onkel Franz. Abschließend reflektiert Bernhard die Beziehungen zu seinem Großvater, der ihn zwar auf das Internat geschickt hat, den er jedoch außerordentlich schätzt, weil er sich nachhaltig für seine künstlerische Ausbildung einsetzte.
Manfred Orlick