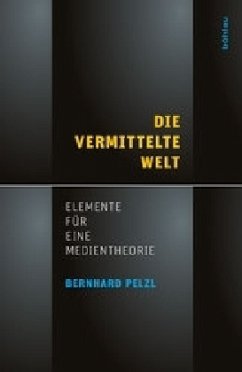Schade – dieser Artikel ist leider ausverkauft. Sobald wir wissen, ob und wann der Artikel wieder verfügbar ist, informieren wir Sie an dieser Stelle.
- Gebundenes Buch
- Merkliste
- Auf die Merkliste
- Bewerten Bewerten
- Teilen
- Produkt teilen
- Produkterinnerung
- Produkterinnerung
Es gehört zu jedermanns Erfahrung, dass Ereignisse von verschiedenen Menschen unterschiedlich wahrgenommen und widersprüchlich wiedergegeben werden - und auch, welche Folgen sich in Beziehungen daraus ergeben: etwa Vorwürfe, dass jemand lüge oder manipuliere, weil er mit einer bestimmten Darstellung ein bestimmtes Interesse verfolge. Vor allem bei Medienberichten wird von Betroffenen immer wieder behauptet, die Ereignisse, welche die Medienberichte zum Gegenstand haben, seien unverstanden, falsch oder zumindest verzerrt wiedergegeben. In seinem Buch entwickelt der Autor ein Konzept für eine…mehr
Es gehört zu jedermanns Erfahrung, dass Ereignisse von verschiedenen Menschen unterschiedlich wahrgenommen und widersprüchlich wiedergegeben werden - und auch, welche Folgen sich in Beziehungen daraus ergeben: etwa Vorwürfe, dass jemand lüge oder manipuliere, weil er mit einer bestimmten Darstellung ein bestimmtes Interesse verfolge.
Vor allem bei Medienberichten wird von Betroffenen immer wieder behauptet, die Ereignisse, welche die Medienberichte zum Gegenstand haben, seien unverstanden, falsch oder zumindest verzerrt wiedergegeben. In seinem Buch entwickelt der Autor ein Konzept für eine umfassende Medientheorie aus der Sicht der Ästhetik, der Rhetorik und der Semiotik, die erklärt, wie man sich trotzdem ein verlässliches Bild von der Welt machen und es erfolgreich kommunizieren kann.
Vor allem bei Medienberichten wird von Betroffenen immer wieder behauptet, die Ereignisse, welche die Medienberichte zum Gegenstand haben, seien unverstanden, falsch oder zumindest verzerrt wiedergegeben. In seinem Buch entwickelt der Autor ein Konzept für eine umfassende Medientheorie aus der Sicht der Ästhetik, der Rhetorik und der Semiotik, die erklärt, wie man sich trotzdem ein verlässliches Bild von der Welt machen und es erfolgreich kommunizieren kann.
Produktdetails
- Produktdetails
- Verlag: Böhlau Wien
- Seitenzahl: 326
- Erscheinungstermin: 18. August 2011
- Deutsch
- Abmessung: 210mm x 135mm
- Gewicht: 525g
- ISBN-13: 9783205786665
- ISBN-10: 3205786661
- Artikelnr.: 32627690
- Herstellerkennzeichnung Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.
- Verlag: Böhlau Wien
- Seitenzahl: 326
- Erscheinungstermin: 18. August 2011
- Deutsch
- Abmessung: 210mm x 135mm
- Gewicht: 525g
- ISBN-13: 9783205786665
- ISBN-10: 3205786661
- Artikelnr.: 32627690
- Herstellerkennzeichnung Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.
Bernhard Pelzl, Dr. phil., geb. 1949, Studium der Sprachwissenschaften, Orientalistik, Geschichte und Philosophie an der Universität Graz
Vorrede
1.Zum Anfang ein Bekenntnis
2. Präsumtionen
2.1. Präsumtion Konstruktivismus
2.1.1 "Modellabhängiger Realismus".
2.1.2 Konstruktivismus und Forschungsethik
2.1.3 "Epistemologischer Konstruktivismus"
2.2 Beziehung als Erkenntniszugang
2.3 "Vermittlung" als Wesensmerkmal menschlicher Existenz
3. Das Ergebnis : vom individuellen Horizont zum gemeinsamen Bild der Welt
4. Instrumente der Vermittlung
5. Zusammenfassung : Grundlegende Elemente für eine Medientheorie
Medienbox S. 30:
(1) Es gibt die wirkliche Welt, den wirklichen Kosmos.
(2) Doch der Mensch hat keinen unmittelbaren Zugang zu ihr und
kein unmittelbares Verständnis von ihr. Deshalb muss ihm die
Wirklichkeit vermittelt werden.
(3) Ungeachtet der Unmöglichkeit der unmittelbaren Erkenntnis der
Wirklichkeit ist der Mensch Teil der wirklichen Welt und damit
wirklich wie diese.
(4) Die Vermittlung der Erkenntnis der Wirklichkeit erfolgt in
menschlichen Beziehungen.
(5) Die Beziehungen sind bestimmt durch die Fähigkeiten der
Wahrnehmung von Phänomenen, die eigene Wahrnehmungen mit
den Wahrnehmungen von anderen zu vergleichen, die eigenen
Wahrnehmungen sowie die Ergebnisse der Vergleiche mit den
Wahrnehmungen von anderen zu bezweifeln, sich für eine
bestimmte Deutung von Wahrnehmungen zu entscheiden und
danach zu leben.
Erster Teil
Ästhetik: Über die Deutung der Welt durch
"Denkgewohnheiten"
I. Einleitung
1. Über die Schwierigkeit zu vermitteln. Zum Einstieg ein Experiment
2. Problem und Zielsetzung
2. Eine neue Gefahr : Betrug und Täuschung durch Technik ?
3. Das "medientheoretische Trivium"
3. Spezialproblem "Ästhetik".
II. Modellhafte Darstellung des Wahrnehmungs-
Vermittlungsprozesses am Beispiel des
"Hochzeitsbildes d es Giovanni Arnolfini" von Jan van Eyck
1. Das "Ereignis"
2. Die Wahrnehmung des Paares Arnolfini - Cenami durch
Jan van Eyck
3. Wie Jan van Eyck durch sein Bild seine Wahrnehmung des
Paares Arnolfini - Cenami weitererzählt
3. Das vordergründige Zeichensystem des
"Hochzeitsbildes" : Allegorien
3.2 Die Überwindung der Allegorie durch Jan van Eyck im
"Hochzeitsbild"
4. Jan van Eyck und die Selbstbezüglichkeit.
5. Der Vermittlungsprozess als "Selbstinszenierung" des
Vermittlers
6. Exkurs zur Selbstinszenierung : "Impression Management" .
6. Kleider, Marken, Image
6.2 Körpersprache
6.2. Gestik
6.2.2 Mimik
6.3 Sprachliche Äußerungen
6.4 Klassifikation von zwei Menschentypen
7. Der Vermittlungsprozess als "Selbstinszenierung"
des Vermittlers - Fortsetzung.
8. Exkurs : Der Palazzo Rucellai als Fallbeispiel für die
Entdeckung der Zeit
9. Vermittlung als "Zeugenschaft"
0. Zusammenfassung : Der Wahrnehmungs-
Vermittlungsprozess im sogenannten "Hochzeitsbild des
Giovanni Arnolfini" von Jan van Eyck .
. Wahrnehmung durch unbeteiligte Dritte : Distanz und
Komplexität .
2. Warum unterschiedliche Wahrnehmung überhaupt
stattfindet : eine Antwort von Umberto Eco
III. Elemente fü r eine Theorie der (Medien-)
Ästhetik.
. Der Ausgangspunkt für eine Theorie der Ästhetik :
unterschiedliche Deutungen ein und desselben Zeichens und
daher unterschiedliche Wahrnehmungen
Medienbox S. 87:
(6) Wahrnehmung erfolgt bei verschiedenen Menschen und
Menschengruppen nach unterschiedlichen Denkgewohnheiten
(Interpretationsregeln).
(7) Aufgrund dieser unterschiedlichen Denkgewohnheiten gibt es
unterschiedliche Deutungen der durch dieselben oder gleichen
Zeichen vermittelten Wahrnehmungen und daher unterschiedliche
Wahrnehmungen.
2. Wie "Denkgewohnheiten" entstehen : Theorien und Modelle
2. Der Mensch in seinen sozialen Beziehungen :
das Modell der "Sozialen Netzwerke"
2.1. Rekonstruktion eines Wahrnehmungskonzepts im
Modell der "Sozialen Netzwerke" : Sozialisation
durch Wechselwirkung des Individuums mit seiner
sozialen Umwelt
2.1.2 Auswirkungen des Wahrnehmungskonzepts des
Modells der "Sozialen Netzwerke" auf die
Wahrnehmung der Welt durch Massenmedien
2.1.3 Eigene E
1.Zum Anfang ein Bekenntnis
2. Präsumtionen
2.1. Präsumtion Konstruktivismus
2.1.1 "Modellabhängiger Realismus".
2.1.2 Konstruktivismus und Forschungsethik
2.1.3 "Epistemologischer Konstruktivismus"
2.2 Beziehung als Erkenntniszugang
2.3 "Vermittlung" als Wesensmerkmal menschlicher Existenz
3. Das Ergebnis : vom individuellen Horizont zum gemeinsamen Bild der Welt
4. Instrumente der Vermittlung
5. Zusammenfassung : Grundlegende Elemente für eine Medientheorie
Medienbox S. 30:
(1) Es gibt die wirkliche Welt, den wirklichen Kosmos.
(2) Doch der Mensch hat keinen unmittelbaren Zugang zu ihr und
kein unmittelbares Verständnis von ihr. Deshalb muss ihm die
Wirklichkeit vermittelt werden.
(3) Ungeachtet der Unmöglichkeit der unmittelbaren Erkenntnis der
Wirklichkeit ist der Mensch Teil der wirklichen Welt und damit
wirklich wie diese.
(4) Die Vermittlung der Erkenntnis der Wirklichkeit erfolgt in
menschlichen Beziehungen.
(5) Die Beziehungen sind bestimmt durch die Fähigkeiten der
Wahrnehmung von Phänomenen, die eigene Wahrnehmungen mit
den Wahrnehmungen von anderen zu vergleichen, die eigenen
Wahrnehmungen sowie die Ergebnisse der Vergleiche mit den
Wahrnehmungen von anderen zu bezweifeln, sich für eine
bestimmte Deutung von Wahrnehmungen zu entscheiden und
danach zu leben.
Erster Teil
Ästhetik: Über die Deutung der Welt durch
"Denkgewohnheiten"
I. Einleitung
1. Über die Schwierigkeit zu vermitteln. Zum Einstieg ein Experiment
2. Problem und Zielsetzung
2. Eine neue Gefahr : Betrug und Täuschung durch Technik ?
3. Das "medientheoretische Trivium"
3. Spezialproblem "Ästhetik".
II. Modellhafte Darstellung des Wahrnehmungs-
Vermittlungsprozesses am Beispiel des
"Hochzeitsbildes d es Giovanni Arnolfini" von Jan van Eyck
1. Das "Ereignis"
2. Die Wahrnehmung des Paares Arnolfini - Cenami durch
Jan van Eyck
3. Wie Jan van Eyck durch sein Bild seine Wahrnehmung des
Paares Arnolfini - Cenami weitererzählt
3. Das vordergründige Zeichensystem des
"Hochzeitsbildes" : Allegorien
3.2 Die Überwindung der Allegorie durch Jan van Eyck im
"Hochzeitsbild"
4. Jan van Eyck und die Selbstbezüglichkeit.
5. Der Vermittlungsprozess als "Selbstinszenierung" des
Vermittlers
6. Exkurs zur Selbstinszenierung : "Impression Management" .
6. Kleider, Marken, Image
6.2 Körpersprache
6.2. Gestik
6.2.2 Mimik
6.3 Sprachliche Äußerungen
6.4 Klassifikation von zwei Menschentypen
7. Der Vermittlungsprozess als "Selbstinszenierung"
des Vermittlers - Fortsetzung.
8. Exkurs : Der Palazzo Rucellai als Fallbeispiel für die
Entdeckung der Zeit
9. Vermittlung als "Zeugenschaft"
0. Zusammenfassung : Der Wahrnehmungs-
Vermittlungsprozess im sogenannten "Hochzeitsbild des
Giovanni Arnolfini" von Jan van Eyck .
. Wahrnehmung durch unbeteiligte Dritte : Distanz und
Komplexität .
2. Warum unterschiedliche Wahrnehmung überhaupt
stattfindet : eine Antwort von Umberto Eco
III. Elemente fü r eine Theorie der (Medien-)
Ästhetik.
. Der Ausgangspunkt für eine Theorie der Ästhetik :
unterschiedliche Deutungen ein und desselben Zeichens und
daher unterschiedliche Wahrnehmungen
Medienbox S. 87:
(6) Wahrnehmung erfolgt bei verschiedenen Menschen und
Menschengruppen nach unterschiedlichen Denkgewohnheiten
(Interpretationsregeln).
(7) Aufgrund dieser unterschiedlichen Denkgewohnheiten gibt es
unterschiedliche Deutungen der durch dieselben oder gleichen
Zeichen vermittelten Wahrnehmungen und daher unterschiedliche
Wahrnehmungen.
2. Wie "Denkgewohnheiten" entstehen : Theorien und Modelle
2. Der Mensch in seinen sozialen Beziehungen :
das Modell der "Sozialen Netzwerke"
2.1. Rekonstruktion eines Wahrnehmungskonzepts im
Modell der "Sozialen Netzwerke" : Sozialisation
durch Wechselwirkung des Individuums mit seiner
sozialen Umwelt
2.1.2 Auswirkungen des Wahrnehmungskonzepts des
Modells der "Sozialen Netzwerke" auf die
Wahrnehmung der Welt durch Massenmedien
2.1.3 Eigene E
Vorrede
1.Zum Anfang ein Bekenntnis
2. Präsumtionen
2.1. Präsumtion Konstruktivismus
2.1.1 "Modellabhängiger Realismus".
2.1.2 Konstruktivismus und Forschungsethik
2.1.3 "Epistemologischer Konstruktivismus"
2.2 Beziehung als Erkenntniszugang
2.3 "Vermittlung" als Wesensmerkmal menschlicher Existenz
3. Das Ergebnis : vom individuellen Horizont zum gemeinsamen Bild der Welt
4. Instrumente der Vermittlung
5. Zusammenfassung : Grundlegende Elemente für eine Medientheorie
Medienbox S. 30:
(1) Es gibt die wirkliche Welt, den wirklichen Kosmos.
(2) Doch der Mensch hat keinen unmittelbaren Zugang zu ihr und
kein unmittelbares Verständnis von ihr. Deshalb muss ihm die
Wirklichkeit vermittelt werden.
(3) Ungeachtet der Unmöglichkeit der unmittelbaren Erkenntnis der
Wirklichkeit ist der Mensch Teil der wirklichen Welt und damit
wirklich wie diese.
(4) Die Vermittlung der Erkenntnis der Wirklichkeit erfolgt in
menschlichen Beziehungen.
(5) Die Beziehungen sind bestimmt durch die Fähigkeiten der
Wahrnehmung von Phänomenen, die eigene Wahrnehmungen mit
den Wahrnehmungen von anderen zu vergleichen, die eigenen
Wahrnehmungen sowie die Ergebnisse der Vergleiche mit den
Wahrnehmungen von anderen zu bezweifeln, sich für eine
bestimmte Deutung von Wahrnehmungen zu entscheiden und
danach zu leben.
Erster Teil
Ästhetik: Über die Deutung der Welt durch
"Denkgewohnheiten"
I. Einleitung
1. Über die Schwierigkeit zu vermitteln. Zum Einstieg ein Experiment
2. Problem und Zielsetzung
2. Eine neue Gefahr : Betrug und Täuschung durch Technik ?
3. Das "medientheoretische Trivium"
3. Spezialproblem "Ästhetik".
II. Modellhafte Darstellung des Wahrnehmungs-
Vermittlungsprozesses am Beispiel des
"Hochzeitsbildes d es Giovanni Arnolfini" von Jan van Eyck
1. Das "Ereignis"
2. Die Wahrnehmung des Paares Arnolfini - Cenami durch
Jan van Eyck
3. Wie Jan van Eyck durch sein Bild seine Wahrnehmung des
Paares Arnolfini - Cenami weitererzählt
3. Das vordergründige Zeichensystem des
"Hochzeitsbildes" : Allegorien
3.2 Die Überwindung der Allegorie durch Jan van Eyck im
"Hochzeitsbild"
4. Jan van Eyck und die Selbstbezüglichkeit.
5. Der Vermittlungsprozess als "Selbstinszenierung" des
Vermittlers
6. Exkurs zur Selbstinszenierung : "Impression Management" .
6. Kleider, Marken, Image
6.2 Körpersprache
6.2. Gestik
6.2.2 Mimik
6.3 Sprachliche Äußerungen
6.4 Klassifikation von zwei Menschentypen
7. Der Vermittlungsprozess als "Selbstinszenierung"
des Vermittlers - Fortsetzung.
8. Exkurs : Der Palazzo Rucellai als Fallbeispiel für die
Entdeckung der Zeit
9. Vermittlung als "Zeugenschaft"
0. Zusammenfassung : Der Wahrnehmungs-
Vermittlungsprozess im sogenannten "Hochzeitsbild des
Giovanni Arnolfini" von Jan van Eyck .
. Wahrnehmung durch unbeteiligte Dritte : Distanz und
Komplexität .
2. Warum unterschiedliche Wahrnehmung überhaupt
stattfindet : eine Antwort von Umberto Eco
III. Elemente fü r eine Theorie der (Medien-)
Ästhetik.
. Der Ausgangspunkt für eine Theorie der Ästhetik :
unterschiedliche Deutungen ein und desselben Zeichens und
daher unterschiedliche Wahrnehmungen
Medienbox S. 87:
(6) Wahrnehmung erfolgt bei verschiedenen Menschen und
Menschengruppen nach unterschiedlichen Denkgewohnheiten
(Interpretationsregeln).
(7) Aufgrund dieser unterschiedlichen Denkgewohnheiten gibt es
unterschiedliche Deutungen der durch dieselben oder gleichen
Zeichen vermittelten Wahrnehmungen und daher unterschiedliche
Wahrnehmungen.
2. Wie "Denkgewohnheiten" entstehen : Theorien und Modelle
2. Der Mensch in seinen sozialen Beziehungen :
das Modell der "Sozialen Netzwerke"
2.1. Rekonstruktion eines Wahrnehmungskonzepts im
Modell der "Sozialen Netzwerke" : Sozialisation
durch Wechselwirkung des Individuums mit seiner
sozialen Umwelt
2.1.2 Auswirkungen des Wahrnehmungskonzepts des
Modells der "Sozialen Netzwerke" auf die
Wahrnehmung der Welt durch Massenmedien
2.1.3 Eigene E
1.Zum Anfang ein Bekenntnis
2. Präsumtionen
2.1. Präsumtion Konstruktivismus
2.1.1 "Modellabhängiger Realismus".
2.1.2 Konstruktivismus und Forschungsethik
2.1.3 "Epistemologischer Konstruktivismus"
2.2 Beziehung als Erkenntniszugang
2.3 "Vermittlung" als Wesensmerkmal menschlicher Existenz
3. Das Ergebnis : vom individuellen Horizont zum gemeinsamen Bild der Welt
4. Instrumente der Vermittlung
5. Zusammenfassung : Grundlegende Elemente für eine Medientheorie
Medienbox S. 30:
(1) Es gibt die wirkliche Welt, den wirklichen Kosmos.
(2) Doch der Mensch hat keinen unmittelbaren Zugang zu ihr und
kein unmittelbares Verständnis von ihr. Deshalb muss ihm die
Wirklichkeit vermittelt werden.
(3) Ungeachtet der Unmöglichkeit der unmittelbaren Erkenntnis der
Wirklichkeit ist der Mensch Teil der wirklichen Welt und damit
wirklich wie diese.
(4) Die Vermittlung der Erkenntnis der Wirklichkeit erfolgt in
menschlichen Beziehungen.
(5) Die Beziehungen sind bestimmt durch die Fähigkeiten der
Wahrnehmung von Phänomenen, die eigene Wahrnehmungen mit
den Wahrnehmungen von anderen zu vergleichen, die eigenen
Wahrnehmungen sowie die Ergebnisse der Vergleiche mit den
Wahrnehmungen von anderen zu bezweifeln, sich für eine
bestimmte Deutung von Wahrnehmungen zu entscheiden und
danach zu leben.
Erster Teil
Ästhetik: Über die Deutung der Welt durch
"Denkgewohnheiten"
I. Einleitung
1. Über die Schwierigkeit zu vermitteln. Zum Einstieg ein Experiment
2. Problem und Zielsetzung
2. Eine neue Gefahr : Betrug und Täuschung durch Technik ?
3. Das "medientheoretische Trivium"
3. Spezialproblem "Ästhetik".
II. Modellhafte Darstellung des Wahrnehmungs-
Vermittlungsprozesses am Beispiel des
"Hochzeitsbildes d es Giovanni Arnolfini" von Jan van Eyck
1. Das "Ereignis"
2. Die Wahrnehmung des Paares Arnolfini - Cenami durch
Jan van Eyck
3. Wie Jan van Eyck durch sein Bild seine Wahrnehmung des
Paares Arnolfini - Cenami weitererzählt
3. Das vordergründige Zeichensystem des
"Hochzeitsbildes" : Allegorien
3.2 Die Überwindung der Allegorie durch Jan van Eyck im
"Hochzeitsbild"
4. Jan van Eyck und die Selbstbezüglichkeit.
5. Der Vermittlungsprozess als "Selbstinszenierung" des
Vermittlers
6. Exkurs zur Selbstinszenierung : "Impression Management" .
6. Kleider, Marken, Image
6.2 Körpersprache
6.2. Gestik
6.2.2 Mimik
6.3 Sprachliche Äußerungen
6.4 Klassifikation von zwei Menschentypen
7. Der Vermittlungsprozess als "Selbstinszenierung"
des Vermittlers - Fortsetzung.
8. Exkurs : Der Palazzo Rucellai als Fallbeispiel für die
Entdeckung der Zeit
9. Vermittlung als "Zeugenschaft"
0. Zusammenfassung : Der Wahrnehmungs-
Vermittlungsprozess im sogenannten "Hochzeitsbild des
Giovanni Arnolfini" von Jan van Eyck .
. Wahrnehmung durch unbeteiligte Dritte : Distanz und
Komplexität .
2. Warum unterschiedliche Wahrnehmung überhaupt
stattfindet : eine Antwort von Umberto Eco
III. Elemente fü r eine Theorie der (Medien-)
Ästhetik.
. Der Ausgangspunkt für eine Theorie der Ästhetik :
unterschiedliche Deutungen ein und desselben Zeichens und
daher unterschiedliche Wahrnehmungen
Medienbox S. 87:
(6) Wahrnehmung erfolgt bei verschiedenen Menschen und
Menschengruppen nach unterschiedlichen Denkgewohnheiten
(Interpretationsregeln).
(7) Aufgrund dieser unterschiedlichen Denkgewohnheiten gibt es
unterschiedliche Deutungen der durch dieselben oder gleichen
Zeichen vermittelten Wahrnehmungen und daher unterschiedliche
Wahrnehmungen.
2. Wie "Denkgewohnheiten" entstehen : Theorien und Modelle
2. Der Mensch in seinen sozialen Beziehungen :
das Modell der "Sozialen Netzwerke"
2.1. Rekonstruktion eines Wahrnehmungskonzepts im
Modell der "Sozialen Netzwerke" : Sozialisation
durch Wechselwirkung des Individuums mit seiner
sozialen Umwelt
2.1.2 Auswirkungen des Wahrnehmungskonzepts des
Modells der "Sozialen Netzwerke" auf die
Wahrnehmung der Welt durch Massenmedien
2.1.3 Eigene E