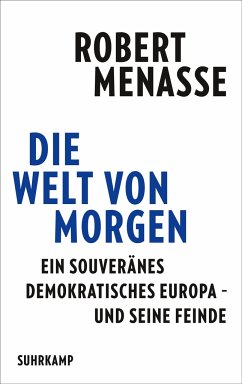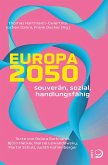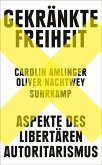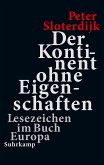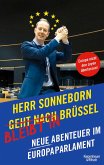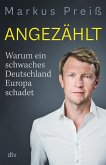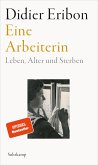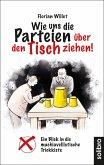Robert Menasse erklärt und verteidigt - im Jahr der Europawahl - die europäische Idee, lädt aber auch dazu ein, die systemischen Widersprüche der Union zu kritisieren und zu überwinden. Die Alternative, vor der wir stehen, ist nicht kompliziert: Entweder gelingt das historisch Einmalige, nämlich der Aufbau einer nachnationalen Demokratie, oder es droht ein Rückfall in das Europa der Nationalstaaten. Das wäre eine weitere Niederlage der Vernunft - mit den Gefahren und Konsequenzen, die uns aus der Geschichte nur allzu bekannt sein sollten.
In Die Welt von Gestern schildert Stefan Zweig das kosmopolitische Europa vor 1914. Als er seine Erinnerungen niederschreibt, existiert es nicht länger, »weggewaschen ohne Spur« von der faschistischen Barbarei. Zweig stirbt 1942. Aber das übernationale Europa bekommt nach 1945 eine zweite Chance. Visionäre stoßen ein epochales Friedensprojekt an, Grenzen fallen, der Nationalismus weicht der Kooperation.
Doch auch dieses Projektkönnte schon bald Geschichte sein. Demokratische Defizite führen zu Protest. Mannigfaltige Krisen machen den Menschen Angst. In vielen Mitgliedstaaten schüren Politiker, die von den Erfahrungen der Gründer nichts mehr wissen (wollen), einen neuen Nationalismus. Heute steht Europa wieder am Scheideweg. Wie wird die Welt von morgen aussehen?
»Die Lehren aus der Geschichte und unsere zeitgenössischen Erfahrungen führen zum selben Schluss: Nur eine gemeinsame transnationale Politik kann eingreifen, kann gestalten und ordnen, was ansonsten Zerstörung, Verbrechen und Misere produziert.«
In Die Welt von Gestern schildert Stefan Zweig das kosmopolitische Europa vor 1914. Als er seine Erinnerungen niederschreibt, existiert es nicht länger, »weggewaschen ohne Spur« von der faschistischen Barbarei. Zweig stirbt 1942. Aber das übernationale Europa bekommt nach 1945 eine zweite Chance. Visionäre stoßen ein epochales Friedensprojekt an, Grenzen fallen, der Nationalismus weicht der Kooperation.
Doch auch dieses Projektkönnte schon bald Geschichte sein. Demokratische Defizite führen zu Protest. Mannigfaltige Krisen machen den Menschen Angst. In vielen Mitgliedstaaten schüren Politiker, die von den Erfahrungen der Gründer nichts mehr wissen (wollen), einen neuen Nationalismus. Heute steht Europa wieder am Scheideweg. Wie wird die Welt von morgen aussehen?
»Die Lehren aus der Geschichte und unsere zeitgenössischen Erfahrungen führen zum selben Schluss: Nur eine gemeinsame transnationale Politik kann eingreifen, kann gestalten und ordnen, was ansonsten Zerstörung, Verbrechen und Misere produziert.«
Perlentaucher-Notiz zur FR-Rezension
Eine schöne Welt malt Robert Menasse in seinem neuen Buch durchaus aus, aber, fragt sich Rezensent Konstantin Johannes Sakkas, wen adressiert er mit dieser Vision? Ein weiteres Mal beschäftigt sich Menasse in diesem Essay mit seinen Leib- und Magenthemen, den Schrecken des Nationalismus und ihrer möglichen Überwindung in Gestalt der Europäischen Union. Das postnationalistische Projekt Europas, lesen wir weiter, schließt ihm zufolge nicht an ein Nation building nach Art der USA an, von außenpolitischer Aggression unterfüttert, sondern an den Vielvölkerstaat der Habsburgermonarchie. Sakkas hat das alles schon öfter bei Menasse gelesen, was ihn an der Schrift stört, ist jedoch nicht der fehlende Neuigkeitswert, sondern die Weigerung des Autors, sich mit Realitäten auseinander zu setzen. Denn anders als für Menasse sind für viele Menschen in Europa nationale Identitäten keine Fiktionen, sondern Teil ihrer Lebensrealität, Menasse gehört als Weltbürger zu einer elitären Minderheit. Die formalen Vorschläge, die Menasse unterbreitet und die auf eine Abschaffung des nationalen in der EU hinauslaufen, kranken in den Augen des Rezensenten jedenfalls daran, dass in der Lebensrealität vieler Menschen die Nation wie auch andere identitäre Kategorien nach wie vor quicklebendig sind. Insofern, so der Tenor der Besprechung, hat Menasse hier ein Buch geschrieben, das sich der realen Situation, in der wir uns befinden, schlicht nicht stellt.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»Niemand schrieb und schreibt in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur so leidenschaftlich über die EU wie der 1954 in Wien geborene Schriftsteller.« Katharina Teutsch Frankfurter Allgemeine Zeitung 20240620