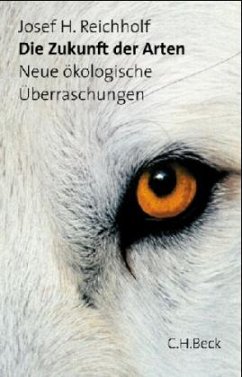Auch wenn manche Medienberichte oder eigene Beobachtungen dies nahezulegen scheinen, unsere heimische Natur befindet sich keineswegs auf dem Rückzug. Was vielen als ein Verarmen, als ein Verschwinden der Natur erscheint, ist zu-nächst nichts anderes als der Ausdruck für den Wandel der Natur. So läßt sich z.B. festhalten: Das beklagte Artensterben findet zumindest in Deutschland nicht im befürchteten Umfang statt. Im Gegenteil, laut Angabe des Bundesamtes für Naturschutz leben in der Bundesrepublik 48000 Tierarten. In der Bilanz sind das 4000 mehr als noch vor zwanzig Jahren.
So erfreulich Zahlen wie diese insgesamt sein mögen, unter den vielen Tier- und Pflanzenarten Deutschlands, Österreichs und der Schweiz finden sich auch solche, die es hier bislang nicht mehr oder nicht in diesem Umfang gegeben hat. Was steckt hinter dieser allgemeinen Dynamik der Natur? Hat es sie schon immer in dieser Form gegeben, und welche Rolle kommt dabei den menschlichen Eingriffen in die Natur und Umwelt zu?
Dieses Buch bietet einen Überblick über den gegenwärtigen Zustand der heimischen Natur und bezieht Stellung zu der heiß diskutierten Frage, welche Natur wir eigentlich schützen wollen.
So erfreulich Zahlen wie diese insgesamt sein mögen, unter den vielen Tier- und Pflanzenarten Deutschlands, Österreichs und der Schweiz finden sich auch solche, die es hier bislang nicht mehr oder nicht in diesem Umfang gegeben hat. Was steckt hinter dieser allgemeinen Dynamik der Natur? Hat es sie schon immer in dieser Form gegeben, und welche Rolle kommt dabei den menschlichen Eingriffen in die Natur und Umwelt zu?
Dieses Buch bietet einen Überblick über den gegenwärtigen Zustand der heimischen Natur und bezieht Stellung zu der heiß diskutierten Frage, welche Natur wir eigentlich schützen wollen.
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
"Anregend" fand Rezensentin Diemut Klärner die Lektüre dieses Buchs über die Zukunft der Arten, auch wenn sie einige Einwände hat. So informiere Josef Reichholf ausführlich über die nachteiligen Folgen einer immer besseren Wasserqualität von Seen und Flüssen. Der Verlust an organischen Abfallstoffen führt laut Reichholf dazu, dass die Zahl der Zuckmücken abnimmt, was sich wiederum nachteilig auf Vögel wie Mauersegler oder Teichrohrsänger auswirkt, die sich von den Mücken ernähren. "Nicht so recht deutlich" macht Reichholf aber, dass es in diesem Spiel auch Gewinner gibt, kritisiert die Rezensentin. Flussperlmuscheln oder die Prachtlibellen zum Beispiel können nur in leidlich sauberem Wasser überleben, hält sie dagegen. Insgesamt scheint die Rezensentin das Buch mit Interesse gelesen zu haben. Auch sie sorgt sich über den Rückgang zahlreicher Arten, die den Veränderungen in der Landwirtschaft zum Opfer fallen. Reichholf wisse "viel zu erzählen" über seine Forschungsarbeiten in Südbayern, habe eigene Ideen zum Naturschutz und wisse diese auch "offensiv zu vertreten". Auch wenn die Rezensentin nicht mit allem einverstanden ist, Stoff zum Nachdenken wurde ihr offensichtlich geboten.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH