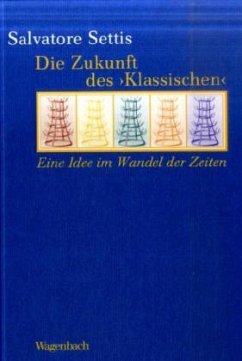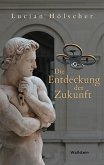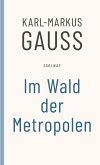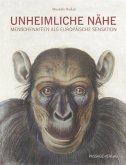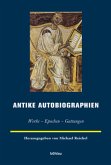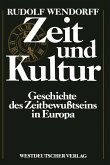Ausgehend von der Diskussion um die Bildung in einer globalisierten Welt untersucht der bedeutende italienische Kunsthistoriker Salvatore Settis den Begriff des "Klassischen" in doppelter Hinsicht: mit Blick auf das "ewig Klassische", aber auch auf die "Klassik" der Antike.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Perlentaucher-Notiz zur FR-Rezension
Heinz Schlaffer kann sich mit Salvatore Settis' Schrift über "Die Zukunft des 'Klassischen'" nicht anfreunden. Obzwar er dem Autor zugesteht, dass sein schmaler Band einen kompakten Überblick über die wechselvolle und widersprüchliche Rezeptionsgeschichte des Klassik-Begriffs zu geben vermag, ist die Mängelliste ungleich länger. So renne Settis beispielweise offene Türen ein, indem er gegen eine unkritische Indienstnahme der Antike für die Gegenwart anschreibe und einen Begriff entmystifizieren will, der seinen Zauber ohnehin längst verloren habe. Zumindest in Deutschland, so Schlaffer, habe jegliche "normative Vorstellung vom Klassischen" schon seit einem halben Jahrhundert ausgedient. "Man darf sich von Settis' Essay weder neues Material noch neue Einsichten zum Nachleben der Antike in der Moderne erwarten", lautet dann auch das ungnädige Rezensentenurteil. Richtig schlimm aber werde es dort, wo sich der "Historiker" Settis zum "Prognostiker" aufschwingt und über unser zukünftiges Verhältnis zum 'Klassischen' orakelt. Hier "verzichtet er auf das zuverlässige Werkzeug seines gelehrten Metiers und überlässt sich den Tagesmeinungen seiner ungelehrten Zeitgenossen", schimpft Schlaffer.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH