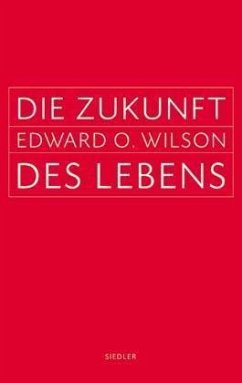Ein Wegweiser für die internationale Umweltdebatte.
Der Evolutionsforscher Edward O. Wilson, "einer der wirklich Großen der Naturwissenschaften" (New York Times Magazine), nimmt uns mit auf eine faszinierende Reise durch die Ökosysteme dieser Welt. Eindringlich schildert er, wie die Menschheit im zwanzigsten Jahrhundert die Zerstörung ihrer natürlichen Umwelt vorangetrieben hat und stellt am Ende die Frage: Wie finden wir zu einer Kultur der Nachhaltigkeit, die unsere Zukunft und die unseres Planeten sichert?
Der Evolutionsforscher Edward O. Wilson, "einer der wirklich Großen der Naturwissenschaften" (New York Times Magazine), nimmt uns mit auf eine faszinierende Reise durch die Ökosysteme dieser Welt. Eindringlich schildert er, wie die Menschheit im zwanzigsten Jahrhundert die Zerstörung ihrer natürlichen Umwelt vorangetrieben hat und stellt am Ende die Frage: Wie finden wir zu einer Kultur der Nachhaltigkeit, die unsere Zukunft und die unseres Planeten sichert?
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Josef H. Reichholf ist sehr angetan von dem Buch des Naturschützers und Biologen Wilson, der darin die Zukunftschancen für die Natur auszuloten versucht. Wie zu erwarten, habe der Autor zwar jede Menge "Schreckensmeldungen" über aussterbende Arten und die verheerende Wirkung des Menschen auf die Natur zu überbringen. Allerdings, so der Rezensent, könne der Autor seine Botschaften "eindrucksvoll belegen", außerdem stelle er seinen "Untergangsszenarien" auch positive Entwicklungen zur Seite. Dadurch, lobt Reichholf, entstehe "Hoffnung". Und so gebe das gleichermaßen "gut geschriebene" wie "ausgezeichnet übersetzte" Buch dem "Natur- und Umweltschutz in der Gegenwart des 21. Jahrhunderts" das, was er brauche: ein "zukunftsfähiges Programm.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
Vom Wert der Natur und dem Drama der Umweltzerstörung
Er ist längst kein Unbekannter mehr: Edward O. Wilson hat sich nicht nur einen Namen als hervorragender Ameisenforscher gemacht, sondern wurde mit seinen Publikationen einer breiteren Öffentlichkeit als Autor bekannt. Nach "Ameisen" und "Der Wert der Vielfalt" legt er nun "Die Zukunft des Lebens" vor. Mit ungeheurer Sachkenntnis und Liebe für sein Forschungsobjekt schildert Wilson die Prinzipien des Lebens und die Vielfalt der Arten. Wie kein zweiter versteht er es, die Natur auf eine schillernde und fesselnde Art zu beschreiben.
Der Mensch als Zerstörer
Aber es ist die Beschreibung eines Niedergangs, denn der homo sapiens hat im letzten Jahrhundert vieles von dem zerstört, was die Natur im Laufe von Jahrtausenden hervorgebracht hat. Wilson meint, der Mensch sei in gewisser Weise einfach zu dumm. Er habe sich vor allem durch das Leben in kleinen Gruppen und durch ökologischen Egoismus weiterentwickelt. Altruismus sei ihm eher fremd, und auch das Vorausplanen für zukünftige Generationen gehöre nicht gerade zu seinen Stärken.
Ausweg aus der Krise
Trotz dieser negativen Beurteilung des Menschen hat Wilson Hoffnung für die Zukunft. Da er der Politik nicht viel zutraut, setzt er dabei vor allem auf das Engagement der Umweltschutzbewegung sowie auf Aktionen von Nichtregierungsorganisationen. Und dennoch, trotz aller Zuversicht, irgendwie wird man das Gefühl nicht los, dieses Buch sei geschrieben worden, um die Menschen zu warnen vor ihrem eigenen Tun und dessen möglichen schrecklichen Konsequenzen. (Mathias Voigt, literaturtest.de)
Er ist längst kein Unbekannter mehr: Edward O. Wilson hat sich nicht nur einen Namen als hervorragender Ameisenforscher gemacht, sondern wurde mit seinen Publikationen einer breiteren Öffentlichkeit als Autor bekannt. Nach "Ameisen" und "Der Wert der Vielfalt" legt er nun "Die Zukunft des Lebens" vor. Mit ungeheurer Sachkenntnis und Liebe für sein Forschungsobjekt schildert Wilson die Prinzipien des Lebens und die Vielfalt der Arten. Wie kein zweiter versteht er es, die Natur auf eine schillernde und fesselnde Art zu beschreiben.
Der Mensch als Zerstörer
Aber es ist die Beschreibung eines Niedergangs, denn der homo sapiens hat im letzten Jahrhundert vieles von dem zerstört, was die Natur im Laufe von Jahrtausenden hervorgebracht hat. Wilson meint, der Mensch sei in gewisser Weise einfach zu dumm. Er habe sich vor allem durch das Leben in kleinen Gruppen und durch ökologischen Egoismus weiterentwickelt. Altruismus sei ihm eher fremd, und auch das Vorausplanen für zukünftige Generationen gehöre nicht gerade zu seinen Stärken.
Ausweg aus der Krise
Trotz dieser negativen Beurteilung des Menschen hat Wilson Hoffnung für die Zukunft. Da er der Politik nicht viel zutraut, setzt er dabei vor allem auf das Engagement der Umweltschutzbewegung sowie auf Aktionen von Nichtregierungsorganisationen. Und dennoch, trotz aller Zuversicht, irgendwie wird man das Gefühl nicht los, dieses Buch sei geschrieben worden, um die Menschen zu warnen vor ihrem eigenen Tun und dessen möglichen schrecklichen Konsequenzen. (Mathias Voigt, literaturtest.de)