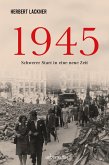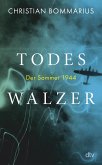Das Porträt des Sommers 1945, wie man es noch nie gelesen hat - ein packend erzähltes Geschichtspanorama
In diesem Sommer ist nichts mehr, wie es war: In den vier Monaten von Mai bis September 1945 bricht die alte Welt zusammen, und eine neue tut sich auf. Das verbrecherische »Dritte Reich« ist am Ende, und eine Zeit der Freiheit, aber auch neuer Konflikte, nimmt ihren Anfang.
Wie erleben die Menschen diesen Sommer - Sieger wie Besiegte, Opfer wie Täter, Prominente wie Unbekannte? Die »Großen Drei« bestimmen auf der Potsdamer Konferenz den Gang der Geschichte, und die Berliner Hausfrau Else Tietze bangt um das Leben ihres Sohnes. Der US-Soldat Klaus Mann spürt Nazi-Verbrecher auf, und in Berlin plant Billy Wilder eine Komödie über das Leben in den Ruinen. Cafés und Restaurants öffnen ihre Türen, und der Rotarmist Wassili Petrowitsch wird von deutschen Kindern um Brot angebettelt. In vielen Geschichten und Szenen, die von Berlin nach Tokio führen, von München nach Paris oder von Bayreuth nach Moskau, fängt Oliver Hilmes die einzigartige Atmosphäre dieser Zeit der Extreme ein: das große Glück und die Hoffnung der Befreiten, das Elend und die Trauer, die Ängste der Besiegten und die neue Freiheit.
In diesem Sommer ist nichts mehr, wie es war: In den vier Monaten von Mai bis September 1945 bricht die alte Welt zusammen, und eine neue tut sich auf. Das verbrecherische »Dritte Reich« ist am Ende, und eine Zeit der Freiheit, aber auch neuer Konflikte, nimmt ihren Anfang.
Wie erleben die Menschen diesen Sommer - Sieger wie Besiegte, Opfer wie Täter, Prominente wie Unbekannte? Die »Großen Drei« bestimmen auf der Potsdamer Konferenz den Gang der Geschichte, und die Berliner Hausfrau Else Tietze bangt um das Leben ihres Sohnes. Der US-Soldat Klaus Mann spürt Nazi-Verbrecher auf, und in Berlin plant Billy Wilder eine Komödie über das Leben in den Ruinen. Cafés und Restaurants öffnen ihre Türen, und der Rotarmist Wassili Petrowitsch wird von deutschen Kindern um Brot angebettelt. In vielen Geschichten und Szenen, die von Berlin nach Tokio führen, von München nach Paris oder von Bayreuth nach Moskau, fängt Oliver Hilmes die einzigartige Atmosphäre dieser Zeit der Extreme ein: das große Glück und die Hoffnung der Befreiten, das Elend und die Trauer, die Ängste der Besiegten und die neue Freiheit.
»Wahrlich, man kann nur staunen. [...] über vieles [...], was dieses so unterhaltsame wie lehrreiche, so anschauungssatte wie menschlich kluge Buch präsentiert.« Literarische Welt, Tilman Krause
Rezensent Robert Probst beobachtet anhand gleich dreier Bücher von Oliver Hilmes, Gerhard Paul und Volker Heise den Trend, Geschichte "emotional und von unten zu erzählen", so auch bei den Wochen und Monaten um das Ende des Zweiten Weltkrieges. Ein bisschen süffisant lässt er sich über die Tendenzen aus, in collageartiger Form aus der Perspektive etwa von einfachen Sekretärinnen, aber auch Soldaten und Nazi-Führungsträgern zu erzählen, vermisst er dabei doch eine quellenkritisch-wissenschaftliche Herangehensweise. Heise schafft für den Kritiker ein "Kriegsende-Panoptikum", das durchaus "plastisch" den Horror des Kriegsendes zu vermitteln mag. Die Stärke liegt hier in den Details, so der Kritiker: Der unerträgliche Gestank und die sich ausbreitenden Krankheiten, Sarg-Mangel, aber auch eine bewegende Episode über zwei Auschwitz-Überlebende, die nach Kriegsende heiraten. Schockierend in ihrer Nüchternheit sind die Berichte über die zahlreichen Vergewaltigungen von Frauen durch die Rote Armee, hält der Kritiker außerdem fest. Hilmes widme sich eher bekannteren Protagonisten wie Thomas und Klaus Mann, was zwar viel Atmosphärisches vermittle, aber keine neuen Erkenntnisse. Gefallen findet bei Probst aber der Band des Historikers Paul, der sich die dreieinhalb Wochen nach Hitlers Suizid anschaut, beschränkt auf die Flensburger Förde, und dafür nicht nur collagierte Eindrücke niederschreibt, sondern diese durch historische Einordnungen ergänzt. Dadurch ergebe sich ein minutiöses Protokoll, das auch zeige, wie schnell sich nach Kriegsende der Mythos der 'sauberen Wehrmacht' verbreiten konnte.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH