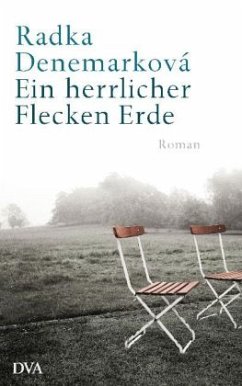Im Osten keine Heimat
Gita muss in ihrem Leben durch mehrere Höllen gehen: von den Nazis als Jüdin gequält, von den Tschechen als Kollaborateurin vertrieben, schließlich von den ehemaligen Nachbarn als habgierige Alte abgestempelt, als sie den Familienbesitz zurückfordert. Doch trotz aller körperlicher und emotionaler Wunden führt Gita den Kampf gegen Unrecht und für Verständigung weiter. Ebenso kompromisslos wie ergreifend schildert dieser preisgekrönte Roman die menschliche Seite der unmenschlichen Geschichte.
Gita will nur nach Hause, sich unter der warmen, weichen Zudecke verkriechen, den geliebten Geruch der Villa in sich aufnehmen. Doch die Realität sieht anders aus, als die Sechzehnjährige 1945 aus dem Konzentrationslager zurück in ihr Heimatdorf, das tschechische Puklice, kommt. Der Familienbesitz wurde konfisziert, Fremde leben jetzt dort, und die Deutschsprachige wird als Staatsfeindin verjagt. Erst sechzig Jahre später kehrt Gita zurück, um die Familie zurehabilitieren. Und wieder schlägt ihr als ehemalige Großgrundbesitzerin der Hass der Dorfbewohner entgegen. Doch längst ist für Gita Weiterleben zur Kampfansage gegen Gewalt und Lüge geworden. Mutig, mit sehr plastischen, unter die Haut gehenden Bildern und mit enormer Sprachmacht wagt dieser kompromisslose Roman, für den die Autorin mit dem bedeutendsten tschechischen Literaturpreis ausgezeichnet wurde, einen Blick auf die verdrängte deutsch-tschechische Nachkriegsgeschichte.
Gita muss in ihrem Leben durch mehrere Höllen gehen: von den Nazis als Jüdin gequält, von den Tschechen als Kollaborateurin vertrieben, schließlich von den ehemaligen Nachbarn als habgierige Alte abgestempelt, als sie den Familienbesitz zurückfordert. Doch trotz aller körperlicher und emotionaler Wunden führt Gita den Kampf gegen Unrecht und für Verständigung weiter. Ebenso kompromisslos wie ergreifend schildert dieser preisgekrönte Roman die menschliche Seite der unmenschlichen Geschichte.
Gita will nur nach Hause, sich unter der warmen, weichen Zudecke verkriechen, den geliebten Geruch der Villa in sich aufnehmen. Doch die Realität sieht anders aus, als die Sechzehnjährige 1945 aus dem Konzentrationslager zurück in ihr Heimatdorf, das tschechische Puklice, kommt. Der Familienbesitz wurde konfisziert, Fremde leben jetzt dort, und die Deutschsprachige wird als Staatsfeindin verjagt. Erst sechzig Jahre später kehrt Gita zurück, um die Familie zurehabilitieren. Und wieder schlägt ihr als ehemalige Großgrundbesitzerin der Hass der Dorfbewohner entgegen. Doch längst ist für Gita Weiterleben zur Kampfansage gegen Gewalt und Lüge geworden. Mutig, mit sehr plastischen, unter die Haut gehenden Bildern und mit enormer Sprachmacht wagt dieser kompromisslose Roman, für den die Autorin mit dem bedeutendsten tschechischen Literaturpreis ausgezeichnet wurde, einen Blick auf die verdrängte deutsch-tschechische Nachkriegsgeschichte.