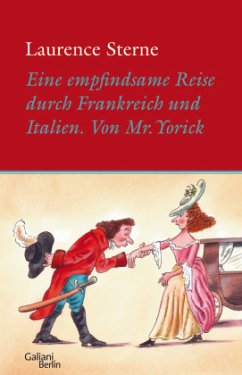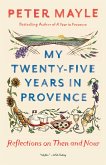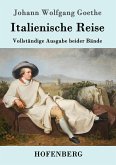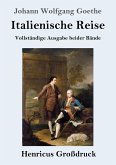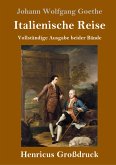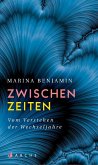Das perfideste Buch der Weltliteratur in der kongenialen Neuübersetzung von Michael Walter.
Ganz Europa lag diesem Buch zu Füßen - und Deutschland dabei vorneweg.
Mitten im Krieg macht sich ein Engländer seiner angeschlagenen Gesundheit wegen nach Frankreich auf und erlebt dort verschiedenste Gefühlsverstrickungen. Das ist der Plot. Wichtiger als der aber ist das Innenleben der Hauptfigur Yorick, eines »man of infinite jest«.
In diesem Buch wird erstmals den Seelenregungen des Individuums aufs Genaueste nachgespürt - und der Erfolg des Romans war unglaublich: Er wurde europaweit ein Seller, Freundeskreise nannten sich nach den Figuren des Romans, »Yorick- Büsten« wurden aufgestellt, fabrikmäßig Andenken mit Motiven des Buches produziert, und eine ganze Epoche der deutschen Literatur heißt nach diesem Buch: die Empfindsamkeit.
Sein Autor erweist sich in der als Meister der Zweideutigkeit: Während in seinem Vorgängerbuch Tristram Shandy noch anarchisch die Zote polterte und das Lachen fontänengleich aus der Bauchregion platzte, tuscht Sterne in der Empfindsamen Reise mit feinstem Pinselstrich subtile Erotik und leise Ironie. Nur wer genau liest, bemerkt, dass dort Literatur wird, was Sigmund Freud erst hundert Jahre später entdeckte: Das Leben des Menschen ist bestimmt von Sexualität. Sterne zeigt sich als der beste Psychologe seiner Zeit, weiß aber auch, dass er dieser eher prüden Zeit um ein Jahrhundert voraus ist - und lockt seine empfindsamen Leser auf vergnüglichste Weise in die Falle. Erstmalig überhaupt ist dies für deutsche Leser nun auch nachzuvollziehen - denn Michael Walters Neuübersetzung ist nicht nur kongenial - sie ist auch die erste deutsche Übersetzung, die nichts verschweigt.
»Yorick-Sterne war der schönste Geist, der je gewirkt hat: wer ihn liest, fühlt sich sogleich frei und schön; sein Humor ist unnachahmlich, und nicht jeder Humor befreit die Seele.«Johann Wolfgang Goethe
Ganz Europa lag diesem Buch zu Füßen - und Deutschland dabei vorneweg.
Mitten im Krieg macht sich ein Engländer seiner angeschlagenen Gesundheit wegen nach Frankreich auf und erlebt dort verschiedenste Gefühlsverstrickungen. Das ist der Plot. Wichtiger als der aber ist das Innenleben der Hauptfigur Yorick, eines »man of infinite jest«.
In diesem Buch wird erstmals den Seelenregungen des Individuums aufs Genaueste nachgespürt - und der Erfolg des Romans war unglaublich: Er wurde europaweit ein Seller, Freundeskreise nannten sich nach den Figuren des Romans, »Yorick- Büsten« wurden aufgestellt, fabrikmäßig Andenken mit Motiven des Buches produziert, und eine ganze Epoche der deutschen Literatur heißt nach diesem Buch: die Empfindsamkeit.
Sein Autor erweist sich in der als Meister der Zweideutigkeit: Während in seinem Vorgängerbuch Tristram Shandy noch anarchisch die Zote polterte und das Lachen fontänengleich aus der Bauchregion platzte, tuscht Sterne in der Empfindsamen Reise mit feinstem Pinselstrich subtile Erotik und leise Ironie. Nur wer genau liest, bemerkt, dass dort Literatur wird, was Sigmund Freud erst hundert Jahre später entdeckte: Das Leben des Menschen ist bestimmt von Sexualität. Sterne zeigt sich als der beste Psychologe seiner Zeit, weiß aber auch, dass er dieser eher prüden Zeit um ein Jahrhundert voraus ist - und lockt seine empfindsamen Leser auf vergnüglichste Weise in die Falle. Erstmalig überhaupt ist dies für deutsche Leser nun auch nachzuvollziehen - denn Michael Walters Neuübersetzung ist nicht nur kongenial - sie ist auch die erste deutsche Übersetzung, die nichts verschweigt.
»Yorick-Sterne war der schönste Geist, der je gewirkt hat: wer ihn liest, fühlt sich sogleich frei und schön; sein Humor ist unnachahmlich, und nicht jeder Humor befreit die Seele.«Johann Wolfgang Goethe

Laurence Sternes "Empfindsame Reise durch Frankreich und Italien des Mr Yorick" liegt in neuer Übersetzung vor. Bei Michael Walter bekommt das literarische Manifest aufgeklärter Empfindsamkeit einen Zug ins feuchtfröhliche Temperament.
Von Hans Ulrich Gumbrecht
Dass der Fuß im achtzehnten Jahrhundert jener weibliche Körperteil war, den enthüllt zu sehen - wie bis heute die Brust oder die Tiefe des Nackens in Japan - oft unbegrenzte erotische Energie unter Männern freisetzte, gehört zum Bildungswissen. In dem 1768, drei Wochen vor dem Tod des Autors, erschienenen "Sentimental Journey Through France and Italy by Mr. Yorick", seinem zweiten großen Buch nach dem Welterfolg und Kanon-Werk "Tristram Shandy" - eine neue deutsche Übersetzung ist gerade erschienen -, steigert Laurence Sterne dann jenen historisch-spezifischen Habitus zu einer persönlich-literarischen Obsession. Kaum hat er die wenigen Meilen des Kanals überquert und ist in Calais angekommen, da stört eine junge Frau Yorick, den mit vielen autobiographischen Zügen Sternes ausgestatteten Reisenden und Erzähler, auf die angenehmste Weise beim Schreiben am Vorwort seines Reiseberichts, indem sie ihm auf der Straße einfach "die Hand reicht". Eine empfindsame Geste wird aus dieser Berührung freilich erst durch die nicht enden wollenden Beschreibungen der Gefühle, welche diese auslöst, einschließlich ihrer psychischen Voraussetzungen: "Fliegt das Herz dem Verstande voran, so erspart es der Urteilskraft unsägliche Mühe - ich war gewiss, sie gehöre einer besseren Klasse von Geschöpfen an."
Jedes momentane Auseinanderstreben der beiden Körper macht die nächste Begegnung ihrer Hände nur noch aufregender: "Die pochenden Pulse in meinen Fingern, die ihre drückten, vermittelten ihr, was in meinem Innern geschah; sie senkte den Blick - einen Lidschlag lang herrschte Schweigen. In dieser Pause, fürcht' ich, ließ ich mir wohl ein leises Bestreben anmerken, ihre Hand enger zu umfassen, spürte ich doch, wie's sich in der meinigen zart regte - nicht als wolle sie mir ihre entziehen - sondern als erwäge sie es - und ich würde sie unfehlbar ein zweites Mal verloren haben, hätte mir nicht der Instinkt mehr als der Verstand die letzte Auskunft in derlei Gefahren gewiesen - sie nämlich lose und auf eine Weise zu halten, als wolle ich sie meinerseits jeden Augenblick freigeben."
So wie Frauenhände seine Sinne in Beschlag nehmen, faszinieren ausgerechnet Zwerge, von denen er Frankreich überbevölkert glaubt, die Empathie des Reisenden aus London: "Ein armer, kleiner, kregler Zwerg, der mir im Kreise gegenüberstand, klemmte zuerst etwas unter den Arm, was ehedem ein Hut gewesen, zog dann seine Schnupftabakdose aus der Tasche und offerierte nach beiden Seiten hin freigiebig eine Prise - Ein Jammer wär's, sollte deine Dose je leer werden! sprach ich bei mir; und steckte einige Sou hinein - wobei ich, deren Wert zu vergrößern, eine kleine Prise aus seiner Dose nahm." Später in Paris, nahe bei der Opéra Comique, stößt Yorick auf ganze Populationen von verwachsenen Zeitgenossen und erhebt seine großherzige Reaktion ins abstrakt Philosophische: "In meinem Innern regen sich gewisse kleine Prinzipien, die mich bestimmen, mitleidvoll zu sein gegen diesen armen versehrten Teil meiner Mitmenschen, denen weder die Statur noch die Stärke eignet, um in der Welt emporzukommen - Ich ertrag' es nicht, mit anzusehen, wenn man einen davon wie mit Füßen tritt."
Kein Geringerer als Gotthold Ephraim Lessing war derart von dieser Prosa beeindruckt, dass er "gern Sterne fünf Jahre seines Lebens abtreten" wollte, "mit der Bedingung aber, dass er hätte schreiben müssen". Für die deutsche Übersetzung der "Sentimental Journey" erfand er den Begriff "Empfindsamkeit", welcher bald zum Namen einer zentralen Epoche der nationalen Kulturgeschichte wurde. Empfindsamkeit war vor allem Selbstbeobachtung, "Beobachtung zweiten Grads", wie Niklas Luhmann präzisierend formuliert, und als solche nahm sie teil an der zentralen intellektuellen Energie, welche die europäische, vor allem die deutsche Philosophie und Literatur in ihrer wohl produktivsten Zeit, im letzten Viertel des achtzehnten und im ersten Viertel des neunzehnten Jahrhunderts, antrieb.
Dass es mit einem Mal für die Intellektuellen ganz unvermeidlich wurde, sich im Akt der Weltbeobachtung selbst zu beobachten, hatte zwei Konsequenzen, die zu Hauptmerkmalen der Empfindsamkeit wurden. Entgegen der sich bis dahin immer nur steigernden cartesianischen Tradition, nach der die Existenz des Menschen in Denken und Bewusstsein aufgehen sollte, entdeckte der Beobachter zweiter Ordnung den Körper, die Sinne und mithin die Sinnlichkeit als Medium der Weltaneignung wieder. Deshalb vor allem ist Yorick so gebannt von der Berührung der Hände.
Einem Beobachter zweiter Ordnung wird aber zugleich bewusst, wie der Inhalt jeder Weltbeobachtung abhängt von seiner jeweiligen Perspektive, und diese Erfahrung macht ihn zum Opfer und zum Mitspieler einer Desintegration des Weltbilds in die potentielle Unendlichkeit von Welt-Versionen und Welt-Variationen. Solche Verunsicherung führte dann bald zur Suche nach grundlegenden Reaktionen auf die Welt, welche alle Menschen teilen sollten, damit aus ihnen ein Bollwerk gegen Perspektivierung und Relativierung erwüchse. Als Lösung des Problems wurde jene Mitleidsfähigkeit, die Yorick so selbstzufrieden an sich entdeckt, zum zweiten Fixpunkt der Empfindsamkeit.
In "Tristram Shandy", dem in Lieferungen zwischen 1759 und 1767 erschienenen Roman, der heute viel höher kanonisiert ist als seine "Empfindsame Reise", hatte Sterne mit einer fiktionalen Autobiographie in ausufernden Digressionen und fast immer sexuell ergiebigen Vieldeutigkeiten die Karte von Desintegration und Pluralisierung des Weltbilds genüsslich gespielt. Offenbar war aber im Lauf der Jahre bei den Lesern - neben der moralischen Entrüstung - eine gewisse Ermüdung eingetreten, so dass Sterne für sein zweites großes Werk wohl deshalb zur Form des Reiseberichts griff, weil diese Gattung mehr Geradlinigkeit und Objektivität versprach. Die Rechnung scheint jedenfalls aufgegangen zu sein, wenn auch die für wohlsituierte junge Männer zum Standard gehörende Grand Tour durch Frankreich und Italien ihre eigene Ambivalenz hatte, nämlich das drohende Umkippen der Bildungsreise in einen Sex-Tourismus avant la lettre. Sternes Reisender freilich widersteht heldenhaft allen Versuchungen, und die zeitgenössischen Leser dankten dem Autor diese Kurskorrektur mit einer Begeisterung, die selbst den Anfangserfolg von "Tristram Shandy" bei weitem überbot.
Das Nachwort von Wolfgang Hörner zu der neuen deutschen Übersetzung der "Sentimental Journey" durch Michael Walter engagiert sich allerdings beinahe leidenschaftlich für die Möglichkeit zweideutiger Lektüren in der Tonalität von "Tristram Shandy", und es gibt eigentlich keinen Grund, einem so gepolten Leser den Spaß zu verderben; so wie ja auch die Tendenz dieser Übersetzung zum rustikalen Register des Lexikons begrüßen wird, wer Spaß an Wörtern wie "sintemalen" und "itzt", "Wittib" oder "Täschgen" hat.
Historisch gesehen jedoch übersieht solches Bestehen auf dem Groben und Schlüpfrigen die Bewegung hin zur ernsten vorrevolutionären Moralität nach dem Stil eines Jean-Jacques Rousseau, wie sie sich in der "Empfindsamen Reise" ein Stück weit vollzieht. Nicht nur ergreift der reisende Engländer Yorick nie die Initiative zur Verführung, er lässt sich gleich gar nicht in Versuchung bringen - und ist lesbar stolz darauf. Stolz, der "Ebbe und Flut des Fiebers" einer schönen Handschuhmacherin in Paris nicht zu erliegen, deren Gatte "mit seiner betroddelten Schlafhaube in einem dunklen, tristen Hinterzimmer hockt"; stolz, eine hübsche fille de chambre, die ihm gleich beide Füße in die Hände spielt und zwei Stunden in seinem Zimmer auf eine zu überbringende Botschaft wartet, nicht berührt zu haben; stolz, mit einer Dame aus Mailand für eine Nacht die Kammer zu teilen, ohne ihre Keuschheit in Gefahr zu bringen - obwohl sie doch großzügig Rotwein zum Abendessen beigesteuert und "ebenso wenig geschlafen hatte" wie Yorick selbst.
Die Empfindsamkeit der späten Aufklärung - "vorromantische Empfindsamkeit" heißt sie bis heute in Frankreich - wollte weder Ausschweifung noch erotische Anämie sein, sondern ein "schlichtes" Moralbewusstsein in harmonischer Konfrontation mit den "gesunden" Trieben. Dass Yorick und die Dame aus Mailand in ein und derselben Kammer des Dorfgasthofs schlafen sollen, ist eine Notlösung, an der die guten Bauern mit den eben "gesunden" Instinkten gar nichts Besonderes finden. In ihrer Arbeit, ihrer Musik, ihren Tänzen entdeckt der Prediger Yorick - wie schon Rousseau - die wahre Religion: "Erst mitten im zweiten Tanz vermeinte ich eine geistige Erhebung zu erkennen, ganz verschieden von jener, welche die Ursache oder Wirkung schlichter Fröhlichkeit bildet. - Mit einem Wort, mir schien, ich sähe die Religion sich in den Tanz mischen. Er habe es sich sein Lebtag lang zur festen Regel bestimmt, sagte der alte Mann, nach dem Abendessen seine Familie zu Tanz und Frohsinn aufzufordern; indem er glaube, ein heiteres Gemüt sei der beste Dank, den ein ungebildeter Bauer dem Himmel darbringen könne - Und auch ein gelehrter Prälat, sagte ich."
Als Bedingung für solch schlichte Moral identifizieren Laurence Sterne und sein Erzähler die Armut, doch im Unterschied zu vielen französischen Philosophen ihrer Gegenwart sehen sie keinen Anlass zur Veränderung jener gesellschaftlichen Ordnung, deren Teil und Ergebnis die Armut ist. Im Gegenteil: sie wird die Bauern für immer vor dem verderblichen Einfluss der Städte und Höfe beschützen: "Arme, geduldige, friedsame, ehrliche Leute! Fürchtet euch nicht; die Welt wird euch die Armut, das Schatzhaus eurer schlichten Tugenden, nicht neiden, noch wird sie darum eure Täler heimsuchen."
Sternes "Tristram Shandy" hat als ein Feuerwerk der Erzählformen, das jegliche Gewissheit unserer Welt-Erfahrung unterläuft, die zweieinhalb Jahrhunderte seit seiner Veröffentlichung gleichsam mühelos überlebt. Er inspirierte eigenständige literarische Traditionen, wie etwa vor 1900 die exquisiten späten Erzählungen des brasilianischen Klassikers Joaquim Machado de Assis, und wirkte fort als nachhaltige Provokation der Subjekt-Philosophie. Hingegen trennt uns die vor allem freudianische Kultur der Selbstverdächtigung von dem guten Gewissen der aufgeklärten Empfindsamkeit. In jeder Distanznahme gegenüber den erotischen Impulsen körperlicher Berührung wollen wir Repression sehen und im Mitleid gegenüber den Unterprivilegierten eine unaufrichtige Strategie moralischer Rechtfertigung. Ohne Faszination aber an der historischen Differenz, ohne das Staunen über eine Kultur, die an gute Bauern und keusche Prälaten glauben konnte, weil sie glauben wollte, müssen wir Sternes "Empfindsame Reise" als eine mühsame Lektüre empfinden.
Laurence Sterne: "Eine empfindsame Reise durch Frankreich und Italien von Mr. Yorick". Neu aus dem Englischen übersetzt und kommentiert von Michael Walter. Mit einem Nachwort von Wolfgang Hörner. Verlag Galiani, Berlin 2010. 359 S., geb., 24,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Die Sensation, die Laurence Sternes "Sentimental Journey" darstellte, die literarische Revolution, die das Buch machte, schildert Rezensent Heinz Schlaffer in seiner Besprechung von Michael Walters Neuübersetzung ziemlich ausführlich. Der neue Stil, ja das Epochengefühl der "Empfindsamkeit" fand in diesem fürs weibliche Geschlecht sehr viel eher als der Riesenroman "Tristram Shandy" zugänglichen Zweitling des Autors Anregung wie auch schon Ausdruck. Der "Werther" wäre ohne die, so Schlaffer, hier geleistete "Demokratisierung" der Wahrnehmung kaum denkbar gewesen. Nicht mehr die Aristokratie stehe im Zentrum, sondern die Alltäglichkeit tiefen Empfindens. Erst gegen Ende kommt die Rezension dann auf die Übersetzung von Michael Walter, der für seine Übertragung des "Tristram Shandy" viel Lob und viel Preis erhielt, zu sprechen. Sehr freundlich fällt Schlaffers Urteil dabei keineswegs aus: mit seinen zu vielen falschen sprachlichen Altertümeleien verfehle Walter im Grunde den Ton des Originals.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH