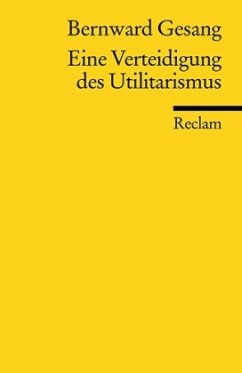Der Utilitarismus ist vermutlich die am weitesten verbreitete ethische Theorie, wird jedoch gegenwärtig vielfach kritisiert. Bernhard Gesang zeigt an vielen konkreten Beispielen: Die Besinnung auf die humanen Aspekte des Utilitarismus kann gerade heute wichtige Argumente und Lösungsvorschläge in die Moraldebatte einbringen.

Bernward Gesang verteidigt den Utilitarismus
In der deutschen Moralphilosophie hat der Utilitarismus nie recht Fuß fassen können. Sowohl Kants Ethik als auch Hegels spekulative Hermeneutik entwickeln dezidiert antiutilitaristische Konzeptionen. Diese philosophische Gegnerschaft hat sich dann im Verlauf des neunzehnten Jahrhunderts zunehmend zu einer ideologischen Gegnerschaft verflacht, die sich vor dem Hintergrund von deutschem Tiefsinn und geistigem Sonderweg häufig mit einer Denunzierung der gesamten englischen Philosophie als seichter Empirismus und platter Demokratismus verband. Aber auch in der englischsprachigen Welt ist der Utilitarismus nie zu einer unangefochten herrschenden moralphilosophischen Lehre geworden, wie immer wieder behauptet wird. Die überzeugendsten antiutilitaristischen Argumente sind in der dortigen Diskussion entwickelt worden. Und auch die von Amerika ausgehende gegenwärtige Renaissance der politischen Philosophie hat keinesfalls zu einem Erstarken utilitaristischer Positionen geführt. Im Gegenteil: Der Antiutilitarismus ist ein durchgehendes Theoriemotiv und eint die gegensätzlichen Lager der Liberalen, Libertären, Kommunitaristen, Diskursethiker und Feministinnen. Wie der Klappentext des vorliegenden Buches behaupten kann, daß der Utilitarismus wohl die "am weitesten verbreitete ethische Theorie" ist, ist mir unerfindlich. Daß die Verwendung der utilitaristischen Bewertungsperspektive vernünftigerweise auch zu den Beurteilungsgewohnheiten des Common sense gehört, bedeutet nicht, daß die Mehrzahl der Theoretiker dem utilitaristischen Paradigma folgt und Moral ausschließlich utilitaristisch buchstabiert.
Läßt sich das Individuum, wie im Utilitarismus Benthamscher Prägung, auf einen Container verrechenbarer Glücks- und Leideinheiten reduzieren? Daß es auch einen anderen Utilitarismus gibt, einen Utilitarismus mit menschlichem Antlitz, versucht Bernward Gesang zu zeigen. Seine schmale Verteidigungsschrift besteht aus drei Kapiteln. Zuerst klärt der Autor den utilitaristischen Grundbegriff, die Zielgröße der Handlungsfolgenbewertung und des Maximierungsprogramms. Was versteht der humane Utilitarist unter Glück und Leid? Gesang spitzt diese zentrale metaethische Erörterung auf einen Vergleich zwischen einem befriedigungstheoretischen und einem wunschtheoretischen Glücksverständnis zu und entscheidet sich für die psychologische Alternative. Es soll nicht darum gehen, gewünschte Weltzustände zu realisieren, sondern positive Empfindungen, angenehme mentale Zustände zu vermehren. Wenn also alles beim alten bleibt, nur möglichst vielen eine Huxley-Droge verabreicht wird, die ihnen die bekannte Welt in neuen Farben erscheinen läßt, muß der humane Utilitarist höchst zufrieden sein. Ein beträchtlicher ethischer Fortschritt ist erreicht worden. Diejenigen, die den Drogenkonsum als entwürdigende Manipulation verwerfen, stützen sich in der Regel auf fundamentale normative Voraussetzungen von menschlichem Wert und menschlicher Würde, die jedoch allesamt nicht in die Währung mentaler Glückszustände konvertierbar sind. Und nur diese Währung zählt. Auch der humane Utilitarismus hält an der wertmonistischen Ausgangsthese der klassischen Nützlichkeitsethik unverrückbar fest. Bereits Mill, der lieber ein unglücklicher Sokrates denn ein glückliches Schwein gewesen wäre, war da schon anspruchsvoller.
Eine Verteidigung des Utilitarismus ist aussichtslos, wenn es ihr nicht gelingt, die Nützlichkeitsethik mit unseren intuitiven Gerechtigkeitsauffassungen in Übereinstimmung zu bringen. Gerechtigkeitsforderungen zu verstehen und zu respektieren ist dem Utilitarismus aus strukturellen Gründen aber nicht möglich. Denn der Utilitarismus kennt lediglich Präferenzen und Empfindungszustände. Nur in psychologisierter Form kann er Gerechtigkeit daher in seinem Kalkül berücksichtigen, als kontingente und subjektive Gerechtigkeitsauffassung, die den Menschen wichtig ist, die ihre moralische Wahrnehmung prägt und deren Mißachtung in ihnen Schmerz und Empörung auslösen wird. Gerechtigkeitsoffen also wird der humane Utilitarismus, indem er auch externe Präferenzen in die Schalen seiner Nutzenwaage legt.
Externe Präferenzen stellen eigentlich ein großes Problem für den Utilitarismus dar, da sie das zum Inhalt haben, was Individuen nicht für sich persönlich, sondern für andere wünschen; und das ist nicht immer das Beste. Würde der Utilitarismus externe Präferenzen zulassen, dann müßte er in amoralischer Neutralität alle Diskriminierungswünsche, rassistischen Einstellungen und sozialschädlichen Ressentiments in die Abwägungsmasse aufnehmen. Daher hat immer der erste Schritt der Utilitarismusrettung darin bestanden, alle offenkundig das Grundprinzip menschenrechtlicher Gleichheit verletzenden externen Präferenzen vorab auszusortieren.
Gesangs externe Präferenzen sind aber von anderer Natur. Sie umfassen das ganze Sortiment moralischer Einstellungen der Gesellschaft und befreien damit den Abwägungskalkül des Utilitarismus vom Diktat unmittelbarer Betroffenheit. Über Abtreibung dürfen nicht nur Frauen befinden, und die Probleme des therapeutischen Klonens dürfen nicht ausschließlich aus der Perspektive der Erbkranken diskutiert und entschieden werden. Unbehaglichkeitsgefühle angesichts des liberalen Abtreibungsrechts, angesichts beginnender genetischer Selbstverfügung, angesichts bestimmter Maßnahmen der Sozialstaatsreform - all das gehört in die utilitaristische Abwägungsmasse und muß mit den Behaglichkeitsgefühlen und Glücksempfindungen der Nutznießer und Reformer verrechnet werden. Wie das aber möglich sein soll, wird nicht deutlich.
Gesang verweist auf die Abwägungskompetenz des Common sense, redet mit Trapp von "Semimessungen", die der Bewertungstätigkeit von Eiskunstlaufjuroren gleichen sollen. Letztlich aber läuft es auf Demoskopie und demokratisches Stimmenzählen hinaus. Von der szientistischen Sozialreligion der bürgerlichen Frühzeit ist wenig übriggeblieben. Das Bedürfnis des Gesangschen Utilitarismus, sich mit den vorhandenen Moralauffassungen in einem Überlegungsgleichgewicht zu befinden, nimmt der Nützlichkeitsethik allen reformerischen Elan, jeden normativen Stachel.
Das letzte Kapitel will den Vorwurf entkräften, daß der Utilitarismus den Menschen unglücklich machen muß, weil er ihn moralisch überfordert und unter einer überbordenden Verantwortung begräbt. Denn nimmt man die Aufgabe der kollektiven Glücksmaximierung ernst, dann muß man sein eigenes Leben vergessen und sich mit der Rolle eines anonymen Funktionärs des Allgemeinwohls begnügen, der sich den ganzen Tag über bei jeder Handlung und jeder Unterlassung zu fragen hat, ob es nicht eine moralisch bessere, für die Allgemeinheit nützlichere Alternative gibt. Um das Glück der Menschen vor den Anforderungen eines radikalen Utilitarismus zu schützen, greift Gesang auf Aristoteles' Lehre von objektiven Glücksbedingungen zurück, die als Schranken utilitaristischer Beanspruchungen dienen sollen. Somit ist ein humaner Utilitarismus ein Utilitarismus innerhalb der Grenzen objektiven Glücks. Freilich fällt es schwer, diesen Glücksobjektivismus mit der empfindungspsychologischen Ausrichtung utilitaristischer Maximierung in Übereinstimmung zu bringen.
WOLFGANG KERSTING
Bernward Gesang: "Eine Verteidigung des Utilitarismus". Verlag Philip Reclam jun., Stuttgart 2003. 141 S., br., 5,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Bernward Gesang: Eine Verteidigung des Utilitarismus Ganz und gar nicht überzeugt ist Wolfgang Kersting von dieser Schrift, mit der Bernward Gesang anhebt, den Utilitarismus zu verteidigen, also jene Ethik, laut der glücklich macht, was nützlich ist. Wie der Rezensent mit leichtem Spott bemerkt, will Gesang einen "Utilitarismus mit menschlichem Antlitz" aufzeigen. Die Thesen des Autors fußen dabei, wie der Rezensent erklärt, auf einem psychologischen Glücksverständnis, dem es nicht darum geht, "gewünschte Weltzustände zu realisieren, sondern positive Empfindungen, angenehme mentale Zustände zu vermehren". Rezensent Kersting erkennt dies an die Logik eines Junkies und erinnert daran, dass selbst John Stuart Mill, einer der Wegbereiter des Utilitarismus, "lieber ein unglücklicher Sokrates denn ein glückliches Schwein gewesen wäre". Auch die zweite große Klippe schafft Gesang in Kerstings Augen nicht: die Nützlichkeitsethik in Übereinstimmung zu bringen mit "unserer intuitiven Gerechtigkeitsauffassung". Hier verweise der Autor lediglich auf generelle "Unbehaglichkeitsgefühle" und die "Abwägungskompetenz des common sense", wodurch Kersting Ethik durch Demoskopie ersetzt sieht.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH