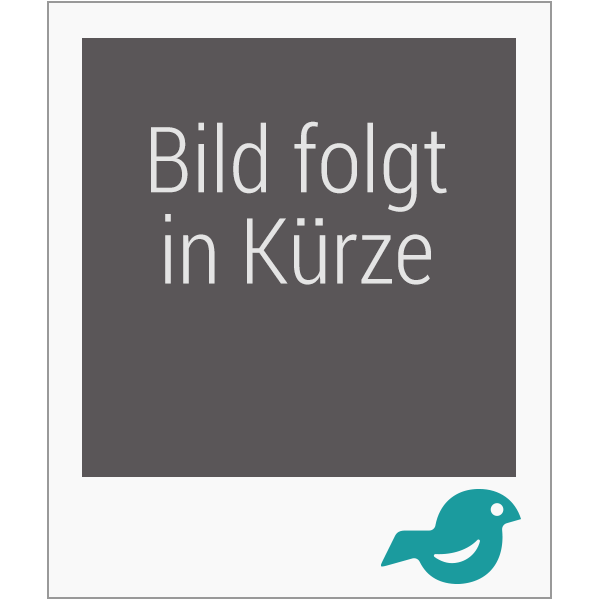Eos, die rosenfingrige, gelbgewandte Göttin der Morgenröte, ist seit jeher erfüllt von einem Gelüst nach schönen Sterblichen. Eines Morgens erblickt sie vom obersten Stock ihres Kölner Hochhauses einen Mann. Er gefällt ihr so gut, daß sie seine Aufmerksamkeit gewinnen will. Paul Anrath aber erweist sich als Zauderer, und die Verführung wird zu einem vertrackten Unterfangen. Denn ihrer alten Kräfte ist sich Eos nicht mehr sicher. Die Verbindungen nach oben sind längst abgerissen.
Liebe und Erotik sind die Themen, die Reinhard Kaiser in seiner wunderbar leicht erzählten Geschichte witzig um einen Mythos flicht. Sein Roman -Eos Gelüst- ist ein kleines Meisterstück sinnlich-geistreicher Unterhaltung.
Liebe und Erotik sind die Themen, die Reinhard Kaiser in seiner wunderbar leicht erzählten Geschichte witzig um einen Mythos flicht. Sein Roman -Eos Gelüst- ist ein kleines Meisterstück sinnlich-geistreicher Unterhaltung.

Schlag nach bei Pauly: Reinhard Kaiser renoviert die Antike
Für Friedrich Schlegel gab es kein schöneres Symbol für die Kraft der Poesie, den "Gang und die Gesetze der vernünftig denkenden Vernunft aufzuheben", als das "bunte Gewimmel der alten Götter". Was aber, wenn sich einer aus der Schar dieser Unvernünftigen in unsere unsinnliche Epoche verirrt? Mit dieser durchaus reizvollen Grundkonstellation wartet "Eos' Gelüst" auf: Eos, "die rosenfingrige, gelbgewandete" Göttin der Morgenröte, erlebt als liebende Frau zu Köln die Nöte der Liebe in Zeiten der Lebensabschnittspartner. Die nicht mehr ganz jugendfrische, beziehungsgeschädigte Malerin mit dem griechischen Künstlernamen erspäht eines Morgens vom Balkon aus den Mann ihrer Träume, lockt den Auserwählten in ihre Wohnung und gibt vor, ihn zeichnen zu wollen. Zwar ziert sich der Gelegenheitsjournalist Paul Anrath zunächst ein wenig, wird dann aber von der ungestümen Eos unter einem Vorwand aus der Stadt gelockt und erliegt in einem Ausflugshotel ihrem heftigen Werben. Es kommt zu "Umarmungen" im Hotelzimmer, zu Eifersüchteleien mit einer ebenfalls in Anrath verliebten Kellnerin. Am Ende kehrt der Liebhaber als Verwandelter, durch Eos' Liebe zu neuem Selbstvertrauen gelangt, zu seiner Lebensgefährtin zurück, und der Malerin bleibt nur das kleine Porträt.
Vor wenigen Jahren war Reinhard Kaiser mit seinem Romanerstling "Der kalte Sommer des Doktor Polidori" die Gratwanderung zwischen Bildungshuberei und höchst unterhaltsamem Erzählen geglückt. In seinem zweiten Roman ist es ihm dagegen nicht gelungen, akademischen Ballast abzuwerfen und aus dem Zusammenprall der mythologischen Figur mit der profanen Gegenwart gehörig Funken zu schlagen. Anstatt einfach eine Geschichte zu erzählen oder einen Liebesroman zu schreiben, hat Kaiser seinen Roman mit anspielungsreichem Zierat überfrachtet. Nur in wenigen Momenten wird hinter den fein gedrechselten Sätzen etwas von der Lust spürbar, die der Autor bei der Entfaltung dieses mythologischen Capriccios gehabt haben muß. Doch sind Eos und Paul über den Schreibtisch, auf dem sie erdacht wurden, niemals hinausgekommen.
"Meine Geschichte steht in vielen Büchern!" läßt Kaiser seine heruntergekommene Göttin verzweifelt ausrufen, als der offenbar nicht humanistisch gebildete Anrath ihr partout nicht glauben will, ja "sie steht sogar im Lexikon". Nun hat der Leser geradezu die Erlaubnis, im Kleinen Pauly nachzuschlagen, was es mit der "vielverliebten Eos" auf sich hat und daß sie einen Geliebten namens Tithonos besaß, den sie in einem goldenen Wagen entführte und ihm ewiges Leben, leider aber nicht ewige Jugend schenkte, bis sie seines Verfalls überdrüssig wurde und ihn in eine Zikade verwandelte. So kommt es, daß Eos in ihrem Kölner Exil eine Grille namens Titho im Terrarium hält und von ihr zotige Litaneien vorgesungen bekommt.
Aus all diesen Details aber entsteht kein Ganzes; das mythologisierende Erzählen greift ins Leere, die allegorische Methode, die das vordergründig realistische Detail durchscheinend macht auf eine mythologische Basis, bleibt im Ansatz stecken und macht in Wahrheit nichts durchsichtiger. "Eos' Gelüst" ist ein Zwitter, bei der die mythologische Ebene die Psychologie verdrängt und umgekehrt die Genauigkeit der Charakterzeichnung im Symbolisch-Allegorischen verschwimmt: "Er umarmt ihren Körper, der ihm . . . aus nichts als Lügen, Fabeln, Schlichen zu bestehen scheint - einen höchst zweifelhaften Körper, von irgendwem an den Haaren herbeigezogen aus dem Nichts hanebüchener Geschichten", schließlich schlüpft die Göttin in beliebige Zeiten und Gewänder ("Wie alt ist sie heute? Wie alt war sie gestern? Wie alt im letzten Jahr? Und vor hundert Jahren? Wen liebte Eos vor hundert Jahren unter dem Namen Elisaweta Ostrowskaja?") und wird zum Sinnbild für das Ewigweibliche, das den tumben Mann zwar hinanzieht und ihm neue Stärke gibt, dadurch aber selbst an Kraft verliert: "Wäre sich Eos ihrer alten Verbindungen noch gewiß, brauchte sie nicht auf die Kraft ihrer Blicke zu hoffen. Es gab Zeiten, da hätte das Wünschen und Wollen genügt. Da wäre sie hinausgetreten und hätte ihre Beziehungen nach oben spielen lassen. Dort oben jedoch rührt sich nichts mehr." Was aber soll der Himmel noch helfen, wenn schon die Göttinnen sich in einen "unbeflügelten Menschen" wie Anrath verlieben und ein begabter Autor daraus einen flügellahmen Roman macht? MATTHIAS BISCHOFF
Reinhard Kaiser: "Eos' Gelüst". Roman. Verlag Schöffling & Co., Frankfurt am Main 1995. 163 S., geb., 34,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main