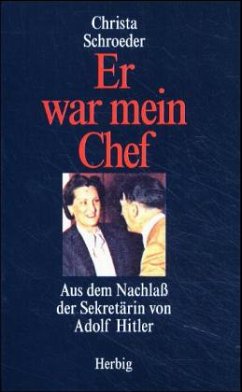1933 bis 1945. Während dieser zwölf Jahre in unmittelbarer Nähe Hitlers erlebte sie den Mann, der dieser Zeit seinen Stempel aufdrückte. Wegen ihrer schlechten Erfahrungen, die sie mit der Presse gemacht hatte, zögerte sie bis zuletzt, ihre Aufzeichnungen zu veröffentlichen.
Was sie wollte, war die "Darstellung ihres Erlebens der Zeit damals". Sie hasste Einstellungen und Unwahrheiten, vor allem aus der Feder von Journalisten und sogenannten Zeitzeugen, mit deren Publikationen sie sich immer wieder auseinandersetzte.
Dass Christa Schroeder nach zwölf Jahren neben Hitler mit ihrer eigenen Vergangenheit, die ihr "viel Distanz abverlangte", niemals ganz fertig wurde, ist einleuchtend, trotzdem sie nie Nationalsozialistin im Sinne des Wortes gewesen war. Des öfteren betonte sie: "Wenn damals 1930 die Annonce nicht von der NSDAP, sondern von der KPD gewesen wäre, wäre ich vielleicht Kommunistin geworden." Bis zu ihrem Tode blieb sie eine kritische, scharf beobachtende und analysierende Frau, hin- und hergerissen zwischen Hitler, ihren Erlebnissen mit Freunden und Größen von damals, dem NS-Regime, dem Grauen des Krieges und den Greueln der Judenvernichtung.
Was sie wollte, war die "Darstellung ihres Erlebens der Zeit damals". Sie hasste Einstellungen und Unwahrheiten, vor allem aus der Feder von Journalisten und sogenannten Zeitzeugen, mit deren Publikationen sie sich immer wieder auseinandersetzte.
Dass Christa Schroeder nach zwölf Jahren neben Hitler mit ihrer eigenen Vergangenheit, die ihr "viel Distanz abverlangte", niemals ganz fertig wurde, ist einleuchtend, trotzdem sie nie Nationalsozialistin im Sinne des Wortes gewesen war. Des öfteren betonte sie: "Wenn damals 1930 die Annonce nicht von der NSDAP, sondern von der KPD gewesen wäre, wäre ich vielleicht Kommunistin geworden." Bis zu ihrem Tode blieb sie eine kritische, scharf beobachtende und analysierende Frau, hin- und hergerissen zwischen Hitler, ihren Erlebnissen mit Freunden und Größen von damals, dem NS-Regime, dem Grauen des Krieges und den Greueln der Judenvernichtung.

Chef nennt sie ihn nur ein einziges Mal - und dann in betonter Distanzierung: "Ich denke an all das Unglück . . ., hervorgerufen durch meinen Chef." Sonst spricht Traudl Junge in ihren 1947 niedergeschriebenen Erinnerungen immer von "Hitler" und nicht selten auch vom "Führer". Und nur einmal unterläuft ihr auf den gut 170 Seiten ihres Manuskripts so etwas wie eine Rechtfertigung. Hitler hat sich, im Frühjahr 1944, einen Bericht Eva Brauns über das "Elend" in München angehört, danach, so Traudl Junge, "schwor er Rache und Vergeltung und versprach, . . . den Feinden alles hundertfach heimzuzahlen." Drei Jahre später rutscht der damals siebenundzwanzig Jahre alten Autorin in eigener Sache dann der Satz heraus: "Leider haben sich diese Drohungen nie erfüllt." Sonst aber stellt sie sich immer aufs neue die Frage, warum sie so "vorurteilslos und unvoreingenommen" Hitlers Einfluß erlegen sei, warum es "erst des ganzen, restlosen Zusammenbruchs" bedurfte, "bis ich meine Klarheit und Sicherheit gewann". Und auch die Antwort ist - wie immer variiert - stets die gleiche: "Wenn man ihn so hörte, wie er harmlose Anekdoten erzählte und liebenswürdig und charmant plauderte, wer konnte dabei an Erschießungen, KZ und solche Dinge denken!" Die Aufzeichnungen aus dem Jahr 1947 sind jetzt zum ersten Mal veröffentlicht worden (Traudl Junge: "Bis zur letzten Stunde". Hitlers Sekretärin erzählt ihr Leben. Unter Mitarbeit von Melissa Müller. Claassen Verlag, München 2002. 272 S., geb., 19,-
JOCHEN HIEBER
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main