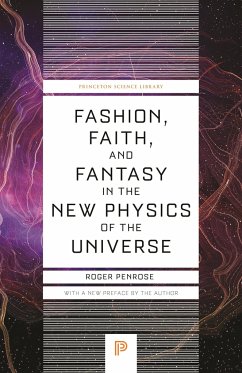What can fashionable ideas, blind faith, or pure fantasy possibly have to do with the scientific quest to understand the universe? Surely, theoretical physicists are immune to mere trends, dogmatic beliefs, or flights of fancy? In fact, acclaimed physicist and bestselling author Roger Penrose argues that researchers working at the extreme frontiers
"Physics has been at an awkward impasse for the past century. Two theories--quantum mechanics and general relativity--are widely believed to be true. . . . But they contradict each other in basic ways--they cannot both be entirely true. InFashion, Faith, and Fantasy in the New Physics of the Universe. . . Roger Penrose, an elder statesman of physics, considers the problem. As intellectually offbeat as he is eminent. . . he ventures here some novel ways in which the two theories might be reconciled."--Wall Street Journal