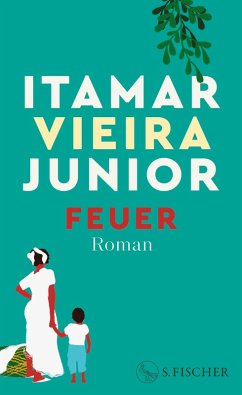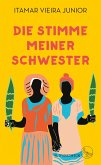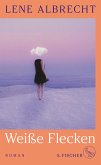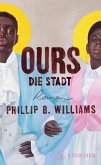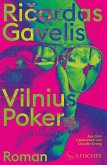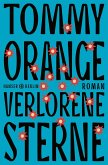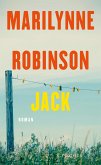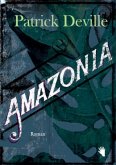Im brasilianischen Hinterland wächst Moisés ohne Mutter auf. Seine ältere Schwester Luzia, der man übernatürliche Kräfte nachsagt, erzieht ihn mit großer Strenge. Sie arbeitet als Wäscherin in einem Kloster, das seit Jahrhunderten die Gegend dominiert. Als sie für Moisés einen Platz in der Klosterschule erobern kann, glaubt sie an eine bessere Zukunft für ihren Bruder. Doch Moisés sieht sich Willkür und Missbrauch ausgesetzt, über die er mit niemandem sprechen kann. Er verlässt heimlich das Dorf und kehrt erst Jahre später zurück, nachdem das Kloster durch ein Feuer zerstört wurde.
In seinem großen, kraftvollen Roman »Feuer« zeichnet Itamar Vieira Junior ein vielschichtiges Bild der ländlichen Gesellschaft Brasiliens und einer Familie, die sich gegen Unterdrückung und jahrzehntelanges Leid stemmt, um die Schatten der Vergangenheit zu überwinden.
Ausgezeichnet mit dem Prêmio Jabuti 2024
In seinem großen, kraftvollen Roman »Feuer« zeichnet Itamar Vieira Junior ein vielschichtiges Bild der ländlichen Gesellschaft Brasiliens und einer Familie, die sich gegen Unterdrückung und jahrzehntelanges Leid stemmt, um die Schatten der Vergangenheit zu überwinden.
Ausgezeichnet mit dem Prêmio Jabuti 2024