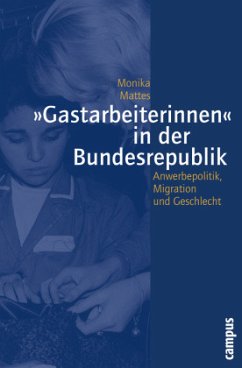Geschichte und Geschlechter
Herausgegeben von Claudia Opitz-Belakhal, Angelika Schaser und Beate Wagner-Hasel
Nicht nur männliche "Gastarbeiter", auch viele Frauen kamen seit 1955 als Lohnarbeiterinnen in die Bundesrepublik. Monika Mattes untersucht erstmals umfassend die auf Frauen zielende Anwerbepolitik, die bestimmt war durch die Nachfrage frauentypischer Branchen nach jungen, körperlich-psychisch stabilen Arbeiterinnen. Zugleich zeigt sie, dass die Migrantinnen mit Protesten und Streiks durchaus ihre Interessen wahrnahmen und dass andererseits die staatlichen Regelungen völlig außer Acht ließen, dass Arbeitsmigration von Anfang an Familienmigration war. Migrantinnen, auch das wird deutlich, wurden auf dem westdeutschen Arbeitsmarkt weniger deshalb benachteiligt, weil sie nicht deutsch waren, als vielmehr deshalb, weil sie Frauen waren.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Herausgegeben von Claudia Opitz-Belakhal, Angelika Schaser und Beate Wagner-Hasel
Nicht nur männliche "Gastarbeiter", auch viele Frauen kamen seit 1955 als Lohnarbeiterinnen in die Bundesrepublik. Monika Mattes untersucht erstmals umfassend die auf Frauen zielende Anwerbepolitik, die bestimmt war durch die Nachfrage frauentypischer Branchen nach jungen, körperlich-psychisch stabilen Arbeiterinnen. Zugleich zeigt sie, dass die Migrantinnen mit Protesten und Streiks durchaus ihre Interessen wahrnahmen und dass andererseits die staatlichen Regelungen völlig außer Acht ließen, dass Arbeitsmigration von Anfang an Familienmigration war. Migrantinnen, auch das wird deutlich, wurden auf dem westdeutschen Arbeitsmarkt weniger deshalb benachteiligt, weil sie nicht deutsch waren, als vielmehr deshalb, weil sie Frauen waren.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
22.05.2006, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Das Niedriglohnregime: "Was Frau Mattes eindrücklich aufzuzeigen vermag, ist, daß Geschlecht eine zentrale Kategorie der Arbeitsmigration darstellte."
19.06.2006, Süddeutsche Zeitung, Fingerfertig und billig: "Mattes zeigt zielsicher die blinden Flecken in der Erforschung der Anwerbepraxis auf. Für die Migrationsforschung bedeutet dies, Aspekte der Geschichte der Einwanderung neu diskutieren zu müssen."
19.06.2006, Süddeutsche Zeitung, Fingerfertig und billig: "Mattes zeigt zielsicher die blinden Flecken in der Erforschung der Anwerbepraxis auf. Für die Migrationsforschung bedeutet dies, Aspekte der Geschichte der Einwanderung neu diskutieren zu müssen."
Das Niedriglohnregime
"Was Frau Mattes eindrücklich aufzuzeigen vermag, ist, daß Geschlecht eine zentrale Kategorie der Arbeitsmigration darstellte." (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 22.05.2006)
Fingerfertig und billig
"Mattes zeigt zielsicher die blinden Flecken in der Erforschung der Anwerbepraxis auf. Für die Migrationsforschung bedeutet dies, Aspekte der Geschichte der Einwanderung neu diskutieren zu müssen." (Süddeutsche Zeitung, 19.06.2006)
"Was Frau Mattes eindrücklich aufzuzeigen vermag, ist, daß Geschlecht eine zentrale Kategorie der Arbeitsmigration darstellte." (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 22.05.2006)
Fingerfertig und billig
"Mattes zeigt zielsicher die blinden Flecken in der Erforschung der Anwerbepraxis auf. Für die Migrationsforschung bedeutet dies, Aspekte der Geschichte der Einwanderung neu diskutieren zu müssen." (Süddeutsche Zeitung, 19.06.2006)