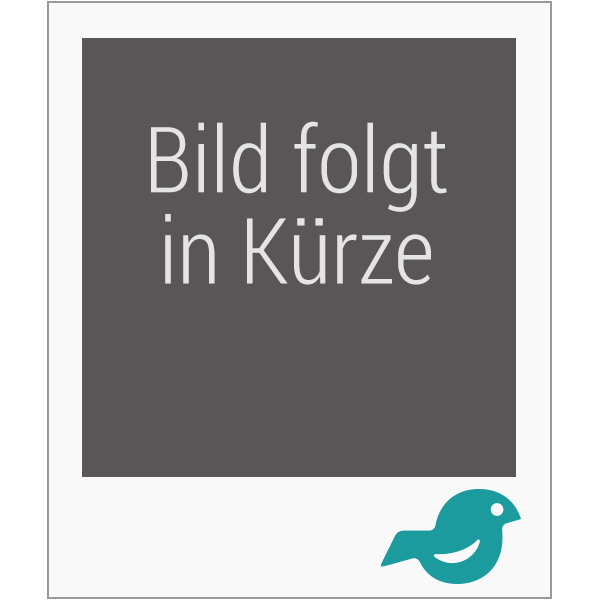Als Thomas Mann einmal nach dem Buch befragt wurde, das ihm in seinem Leben den meisten Eindruck gemacht habe, antwortete er: -Andersens Märchen-. Diese bündige Auskunft hätte Leser und Interpreten eigentlich auf eine Spur setzen müssen, aber erst Michael Maar hat diese Spur entschlossen verfolgt. Es sind die unscheinbaren Kleinigkeiten, welche dem Autor dabei die Anhaltspunkte geben, um die an der Oberfläche gut verborgenen Motive aus Andersens Märchenwelt im -Zauberberg- und anderen Texten Manns aufzuspüren und den poetischen Kalkül zu entschlüsseln, dem sie gehorchen. In Maars Interpretation werden all diese stummen Details plötzlich beredt, erhellen sich durch brillante literarische Detektivarbeit lange umrätselte Passagen. Hans Magnus Enzensberger hat Maars bahnbrechende und spannende Studie zu Recht einen -philologischen Thriller- genannt.

Michael Maar expliziert Thomas Mann / Von Heinz Schlaffer
Wer dem Inhaltsverzeichnis von Maars "Geister und Kunst" den Grundriß des Buchs entnehmen möchte, könnte glauben, er habe eine Sammlung von Kalendergeschichten, Anekdoten oder Märchen vor sich: "Der Regenschirm im Kleiderschrank", "Die entsetzlichen Gäste", "Weiteres vom Pfeffergesellen", "Verblümt und doch klar", "Man kann sich sehr täuschen" lauten die Kapitelüberschriften.
In der Tat, "man kann sich sehr täuschen". Welche Gattung von Buch hier wirklich vorliegt, verrät das Impressum: "Diese Arbeit wurde 1994 an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg als Dissertation vorgelegt." Lange war die Klage ebenso berechtigt wie folgenlos, daß bereits die Sprache der Philologen verrate, wie fremd ihnen ihr Gegenstand, die Literatur, sei und wie wenig sie deshalb den Lesern, die keine Philologen sind, zum besseren Verständnis der Literatur verhelfen könnten. An der hergebrachten literaturwissenschaftlichen Schreibweise, wechselnd zwischen trockener Faktenhäufung und abstrakter Terminologie, hätte sich nichts geändert, wenn nicht die doppelte Hoffnung der anspruchsvolleren Studenten, die Universität sei für sie ein Ort der intellektuellen Bildung und zugleich einer akademischen Karriere, in den letzten Jahren doppelt enttäuscht worden wäre. Seitdem vermehren sich sogar unter den vielgescholtenen Germanisten Dissertationen, die bereits durch ihren Stil ein innigeres, fast mimetisches Verhältnis zwischen dem dichterischen Werk und seinem Interpreten bezeugen. Sie sind für Leser geschrieben, die von einem Buch Wissen und zugleich Vergnügen erwarten, und nicht mehr allein für Fakultätskommissionen.
Leser, die gern Romane und Essays lesen, aber ungern Abhandlungen über sie, werden bei den ersten Sätzen von Michael Maars Buch über Thomas Mann Zutrauen fassen: "Auch Künstler sind nur Menschen und sprechen am liebsten von sich. Sie legen diese Eigenschaft nicht ab, sobald sie sich an die Arbeit machen." So klar und frei läßt sich sagen, was man denkt. Selten nur hat Maars Vermögen, über die Belles lettres im schönen Stil zu schreiben, die paradoxe Folge, daß die Imagination mehr aufgebürdet erhält, als der Verstand zu tragen vermag. So verliert sich Thomas Manns verständliches Zaudern vor einem "empfindlichen und gefährlichen Thema" durch Maars Vergleich, der das Verständnis erleichtern sollte, in den Mirakeln der Tiefsee: "ein Tintenfisch, dem man mit List begegnen muß, wenn man seine Seiten vor der Sepia des Pathos schützen will". An solchen geistreichen, aber rätselhaften Stellen sehnt man sich für einen Augenblick nach der dürren, aber eindeutigen Begriffssprache der gewöhnlichen Literaturwissenschaft zurück.
Das Geheimnis, in das Titel, Überschriften und Metaphorik dieses Buch hüllen, will eine Nachahmung der Geheimnisse sein, die es Thomas Manns Büchern entrissen hat. Kunstvoll wird die Enthüllung verzögert. Erst nach vierzig Seiten zeichnet sich ab, daß sie ihre philologische Grundlage im minutiösen, scharfsinnigen Nachweis von Manns extensiven und intensiven Entlehnungen aus Andersens Märchen hat. Erst in der Mitte des Buches wird das tiefere Motiv für die verblüffende Übereinstimmung der literarischen Motive bei Andersen und Mann genannt: Manns Homosexualität, die sich in Andersens Homosexualität wiedererkennt. Und die "Eleusinischen Mysterien" des "Zauberbergs", seine erotische Theologie einer Erlösung durch Kunst, werden erst am Ende des Buches entschleiert.
Bei einer Umfrage hatte Thomas Mann erklärt, stärker als die Bücher Schopenhauers und Nietzsches hätten ihn die Andersens beeindruckt. Während die Beziehungen zu den beiden Philosophen offensichtlich sind und deshalb von den Interpreten nie übersehen wurden, blieben die zum Märchendichter unbeachtet, weil die realistische Oberfläche und der ironische Ton von Manns Erzählen am wenigsten an das Märchen als Vorbild denken ließen. Doch Maars Spürsinn entdeckt es bereits in der Namengebung: von Gerda und Kai in den "Buddenbrooks", die nach zwei Figuren in Andersens "Schneekönigin" benannt sind (woher auch die eisigen Züge in Gerda Arnoldsens Charakter stammen) bis zu Joachim Ziemßen, in dem der "standhafte Zinnsoldat" wiederkehrt. Sogar für die Beschwörung des toten Ziemßen in einer Spiritistensitzung am Schluß des Romans - gerade diese fragwürdige Szene ist für Maar der Schlüssel zum "Zauberberg" - hat der Geist Andersens die Schirmherrschaft übernommen, denn das Medium Holger ist ein Revenant aus dem Märchen von Holger Danske. Maars genealogische Forschungen decken auf, daß Dutzende von Personen bei Thomas Mann wie ihre Vorfahren bei Andersen heißen, daß sie deren Kleidungsstücke und Charaktereigenschaften geerbt haben und daß sie die gleichen Schicksale erfahren. Die Übereinstimmungen in winzigen Details zwingen bereits durch ihre Fülle zu der Hypothese, diesen seltsamen, verborgenen und wiederholten Anspielungen müsse ein Programm zugrunde liegen. Doppelbödig wird das Werk eines Autors, wenn so vieles auf verdeckte Weise das Werk eines anderen Autors zitiert. In den tieferen Schichten von Manns Romanen werden Märchen erzählt.
Die Frage hätte sich gelohnt, warum es die Märchen Andersens sein müssen. Ihr - freilich etwas zweifelhafter - Vorzug ist es, daß sie der Gefühlswelt des modernen Romans näherstehen als etwa die Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm. Andersen war der erste, der Märchenfiguren mit einer Seele ausstattete, so daß in ihrer Sehnsucht, in Liebesfreude und Liebesleid, in Trauer, Hoffnung, Glück, Erlösung sich die Lebensträume auch der erwachsenen Leser spiegeln konnten. Weil Thomas Mann, darin ein Kind des neunzehnten Jahrhunderts, sich in diesen Seelenlagen wiedererkannte und von ihnen sprechen wollte, lieferten ihm Andersens Geschichten die emotionale Textur für seine Romane, obwohl deren expliziter Text allein der modernen intellektuellen Welt zuzugehören scheint. Während die Ironie seiner Sprache die Souveränität des aufgeklärten Verstandes offen proklamiert, versteckte er seine sentimentale Tragödie von Liebe, Entsagung und Verklärung in einer unterirdischen Märchenwelt.
Der "Zauberberg" hat seinen Namen nicht umsonst. So könnte ein Märchen heißen. Wo bislang den Leser ein Konglomerat aus makabren Krankheitsgeschichten, geistreichen Karikaturen, vagen Zeitdiagnosen und gebildeten Disputationen amüsierte oder auch langweilte, da wird er nach der Lektüre von Maars "Geister und Kunst" nur noch ein Tarnnetz sehen, hinter dem der "Zauberer" (wie Thomas Mann von seinen Kindern hellsichtig genannt wurde) durch "magische Intellektualität" eine zweite Welt erschuf. Hier ist das Märchen selbst verzaubert worden - in einen Roman. Wenn Maar den Zauberbann löst und das Märchen vom Zauberberg aus seinen Splittern zusammenfügt, so entsteht gerade durch diese überraschende Lösung ein neues Problem. Offensichtlich hat ja der Dichter die Hintergründe und Abgründe seiner Komposition so sorgfältig verborgen, daß Millionen von Lesern darüber hinweglasen. Wer von Maar eines Besseren belehrt ist, muß sich nun fragen: War es der Wunsch des Autors, daß er nicht verstanden wurde? Schrieb Thomas Mann sein Werk doppelt, mit einer Innenseite für sich allein? Denn er konnte ja nicht darauf bauen, daß am Ende des Jahrhunderts eine germanistische Dissertation diese Innenseite seiner Privatmythologie nach außen kehren werde.
Verborgen muß werden, was anstößig ist. An einer poetischen Taktik, die lediglich mit den Werken eines anderen Dichters ein Versteckspiel der Zitate treibt und daraus korrespondierende Strukturen zu einem eigenwilligen Ideenkomplex fügt, wäre freilich nichts anstößig. Maar nennt das naheliegende, aber erst durch seine inspirierte Deutung erwiesene Motiv, das Thomas Mann zu dieser Kompositionstechnik gedrängt hat: seine homoerotische Neigung, die er verbergen und gleichzeitig im Verborgenen manifestieren möchte. Weil er seine Wünsche nicht leben konnte, nicht leben wollte, verwandelte er sie in ein Märchenreich der Erfüllung, die mit der Befreiung von ihnen zusammenfiel. Von der Realisierung und gar von der Legalisierung der Homosexualität befürchtete Mann den Verlust metaphysischer und ästhetischer Energien. Er wollte seine von der Norm abweichende Gefühlswelt für die Konstruktion der Werke nützen, aber selbst in den veröffentlichten Werken nicht wirklich veröffentlichen. Nur am Schreibtisch, nur bei der strengen Arbeit an Fiktionen, durfte das Verbotene ins Leben treten, unter der Bedingung, daß es sich in Schattengestalten der normalen Welt, in heterosexuelle Liebespaare verkleide - wie Andersen für seine Sehnsucht nach dem schönen Jüngling die Gestalt der Seejungfrau erfunden hatte, die ihre Liebe zu dem Prinzen nicht aussprechen kann, da sie ihre Zunge verloren hat.
Es ist Maars Ehrgeiz, genau die "Geister" zu zitieren, die Thomas Mann im Spiel zwischen Körper, Phantasie und Stil zu "Kunst" werden ließ. Dem Schreibtisch des Dichters steht der seines Interpreten spiegelverkehrt gegenüber: Was jener aus Lektüren und Träumen in ein Werk überführte, löst dieser wieder in seine Elemente auf. Über die Qualität des Spiegelbildes entscheidet seine Ähnlichkeit mit dem Urbild. Michael Maars Porträt des Schriftstellers Thomas Mann ist unvertraut und wirkt dennoch so glaubhaft wie kein anderes, weil es die befremdlichen Züge des Werks zunächst bewußt und schließlich verständlich macht, ohne ihre Fremdheit zu beseitigen.
Michael Maar: "Geister und Kunst". Neuigkeiten aus dem "Zauberberg". Carl Hanser Verlag, München 1995. 360 S., geb., 45,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main