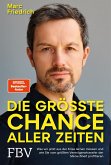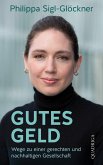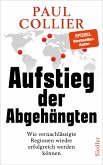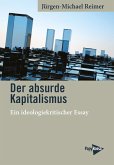Der Begriff „Gerechtigkeit“ wird heute oft inflationär und unscharf verwendet, weil er für unterschiedliche, teils widersprüchliche Forderungen instrumentalisiert wird – von sozialer Umverteilung bis zu individueller Leistungsgerechtigkeit. Politische Akteure nutzen ihn als moralischen Kampfbegriff,
um Emotionen zu mobilisieren und eigene Machtinteressen zu verschleiern. Dadurch verliert er seine…mehrDer Begriff „Gerechtigkeit“ wird heute oft inflationär und unscharf verwendet, weil er für unterschiedliche, teils widersprüchliche Forderungen instrumentalisiert wird – von sozialer Umverteilung bis zu individueller Leistungsgerechtigkeit. Politische Akteure nutzen ihn als moralischen Kampfbegriff, um Emotionen zu mobilisieren und eigene Machtinteressen zu verschleiern. Dadurch verliert er seine präzise Bedeutung und verkommt zu einem populistischen Schlagwort. Letztlich ersetzt die Berufung auf „gefühlte Gerechtigkeit“ oft die notwendige, nüchterne Debatte über faire Regeln und Verantwortlichkeiten.
Dieses Buch zeigt eine Vielzahl von Facetten auf und führt kurze Interviews mit Akteuren aus Politik und Wissenschaft. Unter 26 Gesprächen war für mich die Sichtweise von Deirdre McClosekey höchst interessant. Ich kannte sie bisher nicht. Sie kritisiert die Tendenz, Gerechtigkeit als moralischen Vorwand für ökonomischen Dirigismus zu benutzen, und betont, dass echte Gerechtigkeit auf gegenseitiger Anerkennung von Würde und freier Kooperation beruht – nicht auf staatlichem Zwang. Sie analysiert die Herkunft eines Glaubens an den Kollektivismus: „Wir kommen aus der idealen sozialistischen Gemeinschaft, die wir Familie nennen.“ Zum anderen gibt es leider eine Art kleinbäuerliche Mentalität, die jeden Austausch als Ausbeutung ansieht. Die Gedanken von McClosekey lassen sich in diesen 3 Sätzen zusammenfassen:
1 Erstens ist Gerechtigkeit kein staatlich verordneter Umverteilungsautomat, sondern ein gesellschaftliches Übereinkommen freier Menschen, die sich gegenseitig achten.
2 Zweitens führt die Verwechslung von Fürsorge mit Gerechtigkeit dazu, dass politische Eliten sich anmaßen, Bürger wie unmündige Familienmitglieder zu behandeln.
3 Drittens verhindert ein tiefsitzendes Misstrauen gegenüber Märkten und freiem Austausch die Einsicht, dass Kooperation und Handel zu weit mehr Wohlstand und Fairness führen als jeder dirigistische Kollektivismus.
Michel Abdollahi fordert in seinem Gespräch eine „gleichberechtigte Kommunikation“ zwischen Sender und Empfänger, scheitert jedoch daran, diesen Anspruch konsequent zu denken. Seine Forderung nach einem Diskurs auf Augenhöhe endet dort, wo ihm die Gesprächspartner nicht ins moralische Weltbild passen. Wenn er etwa sagt, dass über bestimmte Aussagen schlicht „nicht diskutiert“ werden soll, offenbart sich der Widerspruch: Er will keinen Dialog, sondern eine diskursive Einbahnstraße, in der unangenehme Meinungen ausgesperrt werden.
Besonders irritierend ist seine nostalgische Vorstellung, früher sei der Diskurs „steuerbar“ gewesen – eine gefährliche Sehnsucht nach medialer Kontrolle, die den freien Austausch in sozialen Netzwerken als Bedrohung empfindet. Wer meint, Polarisierung müsse aufhören, während er gleichzeitig politische Lager spaltet, indem er Parteien pauschal aus dem demokratischen Spektrum ausgrenzt, betreibt keine Deeskalation, sondern subtile Eskalation unter moralischem Deckmantel.
Sein Anspruch, die Menschen wieder „zufrieden“ machen zu wollen, ist bevormundend. Es geht ihm weniger um Mündigkeit, sondern um Ruhe an der Oberfläche – erkauft durch Diskursverengung. Dabei spricht er in der Grenzziehung zwischen demokratischen und nicht-demokratischen Parteien.
Das Buch zeigt die ganze, spannende Vielfalt dieses Begriffes und behandelt eine breite Palette an Themen, z.B. „Ist KI eine Bedrohung für die Gerechtigkeit?“ Prof. Spitzer beschreibt Künstliche Intelligenz als epochale Umwälzung, erkennt aber fast nur die Gefahren für die Demokratie und blendet weitgehend deren Chancen für Freiheit, Teilhabe und individuelle Ermächtigung aus.
Seine Argumentation folgt einer alten Kulturpessimismus-Linie: Neue Technologien dienen angeblich immer zuerst einer „kleinen Oberschicht“ und bedrohen die Mündigkeit des Einzelnen. Dabei verkennt er, dass gerade KI das Potenzial besitzt, Bildung, Wissen und unternehmerische Möglichkeiten demokratischer zu machen als je zuvor – wenn man sie nicht durch übervorsichtige Reglementierung einengt.
Sein paternalistisches „Wir Europäer dürfen das nicht zulassen“ enthüllt das eigentliche Ziel: die Techniknutzung von oben zu steuern, anstatt den Bürgern die Souveränität zuzutrauen, selbst zu entscheiden, wie sie KI in ihrem Leben einsetzen. Dass Spitzer in KI nicht mehr als ein Werkzeug der Mächtigen sieht, ist weniger ein Urteil über die Technologie, als über sein eigenes Menschenbild: Es fehlt ihm das Vertrauen in die Gestaltungsfähigkeit freier Bürger.
Sein Bezug auf „Fake News“ und die Wahlentscheidung in den USA wirkt dabei wie ein ablenkender Popanz, der suggerieren soll, der Bürger sei ohnehin manipulierbar und müsse vor sich selbst geschützt werden. Diese Haltung degradiert Menschen zu Objekten staatlicher Fürsorge – eine Sichtweise, die den Begriff der Gerechtigkeit geradezu ad absurdum führt.
Insgesamt ein wertvolles Buch, das Unterschiedliches zumindest auf Buchseiten zusammenbringt.