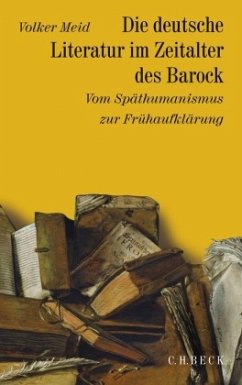"Wer sich einen wirklichen Überblick über gattungs- und formgeschichtliche Zusammenhänge einer literarhistorischen Epoche verschaffen möchte, wird in der Geschichte der deutschen Literatur einen hervorragenden Ausgangspunkt für eigene Fragen und Studien finden (?) (Sie) kann in ihrer Klarheit und Übersichtlichkeit, aber auch als schreibökonomische Leistung kaum hoch genug gewürdigt werden."
Zeitschrift für Germanistik, Timm Reimers
Zeitschrift für Germanistik, Timm Reimers

Sage mir, Muse, die Namen der viel vergessenen Dichter: Volker Meid schlägt sich souverän durch die literarischen Wälder des Barock.
Als vor genau dreißig Jahren "Das Treffen in Telgte" von Günter Grass erschien, waren die Kritiker und Leser des Lobes voll. In dieser längeren Erzählung gelingt das beispiellose Kunststück, die kaum noch bekannten Dichter des literarischen Barock scheinbar mühelos zu versammeln und zu porträtieren. Ihre heftigen, hier natürlich erfundenen Literaturdebatten im Jahre 1647 entwirft Grass zudem als Pastiche für die dreihundert Jahre später gegründete Gruppe 47.
Inzwischen weiß man, wie genau und kundig er dabei zu Werke ging, was seinen Mut zur Synthese eher größer als kleiner erscheinen lässt. Denn der Barock ist historisch wie sprachlich oft sperrig, dem Publikum in weite Ferne gerückt und entsprechend schwierig zu vermitteln. Grass setzt damit hohe Maßstäbe an Eleganz und Erzählgeschick, die auch für Literarhistoriker - trotz aller Unterschiede des Metiers - nicht ganz ohne Geltung sein können.
Während Grass seinen Stoff aber finden und erfinden, also zugleich zitieren und ironisch verfremden darf, hat der Geschichtsschreiber sich solcher Lizenzen zu enthalten. Ihm bleiben unerwartete Perspektiven, Aufklärung verschatteter Kontexte, Einbeziehung unbeachteter Genres und Autoren, um einer bloß konventionellen Stoffansammlung zu entgehen. Volker Meids große Darstellung des Barock schöpft solche Möglichkeiten jetzt umsichtig aus, zudem schließt sein Buch die empfindlichsten Lücken der meisten Literaturgeschichten. Es ist enzyklopädisch und forschungsaktuell, rückt den literarischen Kanon in einen wohlproportionierten kulturhistorischen Rahmen und observiert aufmerksam zahllose Randphänomene und Kuriositäten. Im fast abgeschlossenen Bogen der zwölfbändigen - von Helmut de Boor und Richard Newald begründeten - "Geschichte der deutschen Literatur" bildet dieser Tausendseiter einen besonders gewichtigen Stein.
Die klassische Gattungstrias Lyrik - Drama - Prosa wird von einem gut hundertseitigen Epochenpanorama zu Beginn und einem knappen Brückenschlag zur Frühaufklärung am Schluss gerahmt. Im Schatten des politischen Absolutismus und der Kriege des siebzehnten Jahrhunderts entsteht in den Sprachgesellschaften, an Schulen und Universitäten sowie auf dem stetig wachsenden Zeitungs- und Buchmarkt erstmals eine breite soziale Formation literarischen Lebens.
Intellektuell verwurzelt ist es in der Klugheits- und Affektenlehre, der Emblematik und Rhetorik, der lateinisch-europäischen Literatur und Poetik, der Theater- und Festkultur, die allesamt seit Beginn des achtzehnten Jahrhunderts allmählich reformiert und abgelöst werden. Meid skizziert diese großen bildungs-, kunst- und mentalitätsgeschichtlichen Entwicklungslinien mit leichter Hand. Sein Thema ist die Literatur, langatmige Hinführungen und umständliche theoretische Positionierungen kommen für ihn nicht in Frage.
Warum es sich lohnt, in diesem Buch ausgiebig kreuz und quer zu lesen, kann man klar beantworten. Mitgebrachte Lieblingslektüren wie die galante Barocklyrik, die "bewährete Beständigkeit" tragischer Märtyrer oder die pikarischen Abenteuer eines Simplicissimus werden an jeder Stelle vertieft und um weitere unbekannte Beispiele ergänzt. Überall wird man hier auf Werke und Autoren aufmerksam gemacht, von denen bestenfalls noch ein paar Spezialisten gehört haben und von denen überhaupt keine neueren Editionen existieren. Barockfreunde sind neugierige Bibliotheksbewohner, Meid eröffnet ihre verborgenen Schätze und Entdeckungen jetzt aber einem größeren Publikum.
Gegenüber älteren Literaturgeschichten erfährt man jedoch nicht nur viel über entlegene Einzeltitel, sondern über sonst kaum berücksichtigte Genres. In den zweihundert Seiten zur Lyrik finden neben der Opitzschule oder der geistlichen Dichtung eben auch Panegyrik, Epigrammatik oder didaktische Poesie ihren Platz. Im ähnlich umfangreichen Abschnitt zum Drama wird die europäische Theater- und Operngeschichte ebenso erfreulich berücksichtigt wie die Festspielkultur mit ihren Turnieren, Maskenspielen und Triumphzügen.
Bei der Erzählliteratur rücken neben die riesigen Barockromane etwa Predigten und Reisen oder die noch immer unterschätzten kleineren novellistischen, dokumentarischen und journalistischen Formen. Und auch das weite Feld der Fachprosa und Gebrauchsliteratur wird eingehend gewürdigt, endlich findet die längst erkannte literaturgeschichtliche Bedeutung von Schriften zur Briefstellerei, Verhaltenslehre, Haushaltung, Gesundheit oder Kriminalität breitere Anerkennung. Schon Albrecht Schöne hat mit seiner großen Textanthologie aus dem Jahre 1963, die auch Günter Grass für sein "Treffen in Telgte" ausgiebig nutzte, solch einen weiten kulturhistorischen Blick auf das Zeitalter geworben. Jetzt hat sich diese weltoffene Perspektive bis in die aktuellste Literaturgeschichte des Barock durchgesetzt. Die Forschung und das Lesepublikum können davon noch lange zehren.
ALEXANDER KOSENINA
Volker Meid: "Die deutsche Literatur im Zeitalter des Barock". Vom Späthumanismus zur Frühaufklärung 1570-1740. Verlag C. H. Beck, München 2009. 984 S., geb., 78,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Begeistert hat Rezensent Alexander Kosenina diese Geschichte der deutschen Barockliteratur von Volker Meid gelesen. Die umfassende Darstellung, die im Rahmen der zwölfbändigen von Helmut de Boor und Richard Newald begründeten "Geschichte der deutschen Literatur" erschienen ist, bietet in seinen Augen in vieler Hinsicht mehr als ältere Literaturgeschichten. Sie zeichnet sich für ihn aus durch ihr anschauliches Epochenpanorama, durch ihre kundige Darstellung von Lyrik, Drama und Prosa im Barock, durch eine Fülle von Autoren und Werken, die bisher nur Spezialisten vertraut waren. Er hebt Meids Beschäftigung mit sonst wenig berücksichtigten Genres wie Briefstellerei, Verhaltenslehre, Haushaltung, Gesundheit oder Kriminalität hervor, über die er hier viel erfahren hat. Die großen bildungs-, kunst- und mentalitätsgeschichtlichen Entwicklungslinien werden zu seiner Freude leichthändig geschildert. Überhaupt lobt er die Lesbarkeit des Werks, den Verzicht auch auf "langatmige Hinführung" und "umständliche Positionierungen". Zudem bescheinigt er dem Band, die Lücken der meisten Literaturgeschichten zu schließen, "enzyklopädisch und forschungsaktuell" zu sein.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH