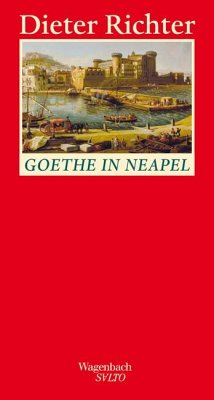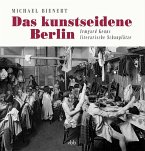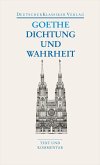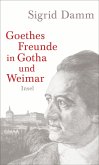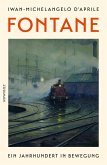»Gestern dacht' ich: entweder du warst sonst toll, oder du bist es jetzt.« Goethe scheint recht verwirrt gewesen zu sein in Neapel, wie diese Zeilen verraten.Immerhin war Neapel die größte Stadt, die er zeitlebens besuchte, und gegendas laute Straßenleben der süditalienischen Metropole schien ihm Rom wie einkühler, ruhiger Ort des Nordens.Der Neapel-Kenner Dieter Richter lässt uns an Goethes Befremden, aber auchan seiner Begeisterung teilhaben: über den öffentlichen Charakter des Volkslebensmit Lastträgern, Bootsleuten, Fischern, Eseltreibern und unzähligenKindern. Über die bunten und bizarren Formen der neapolitanischen Volksfrömmigkeit.Über das Schauspiel der ungewohnten Vegetation, der Früchte, derLandschaft, des Meeres. Über den feuerspeienden Vesuv. Und schließlich überdie Kunst, von den antiken Monumenten (wie dem Tempel in Paestum) zu denin Neapel lebenden Künstlern und Lebenskünstlern, deren Gesellschaft derreisende Goethe sucht.
Bitte wählen Sie Ihr Anliegen aus.
Rechnungen
Retourenschein anfordern
Bestellstatus
Storno