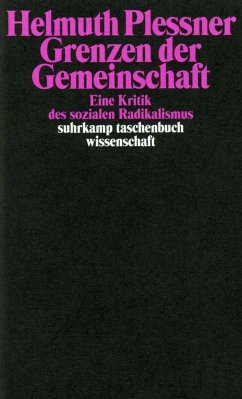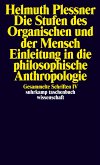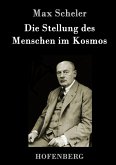Plessners Grenz-Schrift galt seit 1924 als Geheimtip. Entlang einer für deutsche Verhältnisse seltenen Limitierung von Gemeinschaftsutopien sucht sie durch die Denkfigur einer »Sehnsucht nach den Masken« ein »Gesellschaftsethos« zu begründen, das sich in den Kernkategorien »Distanz«. »Spiele, »Zeremonie und Prestige«, »Diplomatie und Takt« verdichtet. Wegen seiner jüdischen Herkunft 1933 zur Emigration gezwungen. entging Plessner in den Niederlanden während des Krieges nur knapp dem Zugriff der Gestapo. Nach 1945 spielte er als Remigrant neben Adorno, Horkheimer, Löwith und René König eine bedeutende Rolle in der intellektuellen Konsolidierung der bundesrepublikanischen öffentlichkeit.
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Nicht mehr und nicht weniger als "einer der kraftvollsten Texte der theoretischen Literatur des 20. Jahrhunderts" ist dieses vor achtzig Jahren erschienene, nun endlich an prominenter Stelle neu veröffentlichte Buch, meint Ulrich Raulff. Die Bedeutung des Buches sieht er darin, dass man nach der Lektüre die Gesellschaft ganz neu sehen wird, "mit einem kalten, klaren Blick". Der Text wurde bei seinem Erscheinen viel diskutiert, dann aber völlig vergessen, erst Anfang der achtziger Jahre setzte eine Renaissance ein. Erst nach dem Ende der, so Raulff, "ideologischen Kapellen und Glaubensgemeinschaften" hatte man für den polemischen Essay wieder ein Ohr für die Kühle, mit der Plessner, der studierte Zoologe, den Menschen beobachtete. Seine Hauptthese war die vom Trieb des Menschen zur Distanznahme, zur Künstlichkeit, zu Masken und Spiel. Und der Rezensent hält es für kein geringes Verdienst, dass dieses Buch "bis heute quer" steht nicht nur zu den Texten seines Entstehungsumfelds, sondern auch zu den gegenwärtigen Diskursen.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»[Man] stößt immer wieder auf Formulierungen, die man sofort auswendig lernen möchte. Und man begegnet einem ebenso konsequenten wie heute unzeitgemäßen Denken ...« Jens Nordalm DIE WELT 20241230