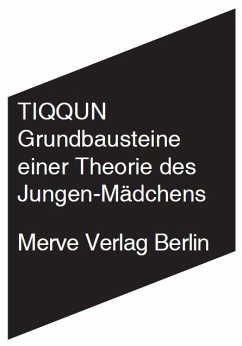Das Mädchen (la Jeune-Fille) ist die Gestalt, die Ewig-Weibliches und ewigeJugend in sich vereint. Seinen Ursprung hat es im Bankrott des von der totalenKommerzialisierung überrannten Feminismus. Einzig fähig zu konsumieren(sowohl in der Freizeit wie bei der Arbeit), ist das Mädchen zugleich dasluxuriöseste Konsumgut, das gegenwärtig in Umlauf ist: die Leit-Ware, diedazu dient, alle anderen zu verkaufen. Mit dem Mädchen wird Wirklichkeit,was sich nur die überdrehtesten Krämerseelen erträumten: die autonomeWare, die spricht und geht, die lebende Sache. Doch woran erkennt man es?Zunächst daran, dass es ist, was es zu sein scheint, sonst nichts. Zum zweitenhat alles, was das Mädchen tut, etwas Professionelles an sich, da esseine gesamte Existenz als eine Frage des Managements betrachtet. AlsEigentümerin ihres Körpers, verkauft das Mädchen ('Sternchen', Model,Reklame, Bild) seine 'Verführungskraft' wie man einst seine 'Arbeitskraft'verkaufte. Selbst seine Liebschaften sind Arbeit, und wie jede Arbeit prekär.Schließlich altert das Mädchen nicht, es verwest.

Ist das Philosophie? Oder Kunst? Oder Vorbote eines neuen Kommunardismus? In Frankreich verfassen Autorenkollektive "Grundbausteine einer Theorie des Jungen-Mädchens" - und werden jetzt auch in Deutschland entdeckt
Es ist schon ein paar Jahre her, dass Tiqqun in Paris die erste Version seiner "Grundbausteine einer Theorie des Jungen-Mädchens" veröffentlichte, aber erst jetzt wird dieses eigenartige Traktat auch in Deutschland entdeckt - und mit ihm ein neues Genre: Jenseits der sogenannten Meisterdenker, neben dem klassischen philosophischen Essay tauchen in Frankreich immer mehr Schriften auf, deren Verfasser anonyme Kollektive sind. Auch die anarchorevolutionäre Kampfschrift "Der kommende Aufstand", deren anonyme Autoren sich hinter dem Titel "Unsichtbares Komitee" verbergen, wird in Zusammenhang mit der Autorengruppe Tiqqun gebracht, obwohl die Verleger energisch betonen, es handele sich nicht um dasselbe Verfasserteam.
Das Wort "Tiqqun" hat seine Wurzeln im Hebräischen: Tiqqun Olam kann man als "Reparatur der Welt" übersetzen - und um nicht weniger geht es diesem Kollektiv. Für seine "Grundbausteine" erfand es eine Kunstfigur, das "Jungen-Mädchen", ein geschlechtsloses, androgynes Wesen, das "ein Frauenaufreißer in der Disco" ebenso sein kann wie die "städtische Single-Frau, die zu sehr an ihrer Consulting-Karriere hängt" und alle Probleme einer kapitalistisch überformten Gesellschaft zu verkörpern hat.
Das "Junge-Mädchen" ist eine Art Olimpia des 21. Jahrhunderts, eine Schreckfigur, die alle menschlichen Züge verloren hat, das vollendete Produkt eines Kapitalismus, der in jede Pore, ins Fühlen und Denken vorgedrungen ist. "Das Junge-Mädchen will keine Geschichte . . . Das Junge-Mädchen bewegt sich wie eine lebendige Maschine vorwärts, die vom Spektakel gesteuert wird und sich in Richtung des Spektakels bewegt. - ,Treue ist schon wichtig!'" - "Der Endlichkeit stellt das Junge-Mädchen das Gewimmel seiner Organe entgegen . . . Die ,Liebe zum Leben', derer sich das Junge-Mädchen so rühmt, ist in Wahrheit nur sein Hass auf die Gefahr . . . Das Junge-Mädchen ist schon alt, weil es weiß, dass es jung ist." So geht es endlos weiter. Die "Grundbausteine" sind keine theoretische Schrift, sondern eine poetisch-suggestive, aphoristische Material- und Thesensammlung.
Methodisch wie ideologisch verdanken diese neuen Traktate viel dem soziologischen Essayismus von Siegfried Kracauer, der ausgiebig zitiert wird, und der Phänomenologie von Roland Barthes: Wie dessen 1957 erschienene "Mythologies" beginnt Tiqqun mit einem analytischen Blick auf Alltagsphänomene, der in eine marxistische Gesellschaftskritik mündet. Beobachtet werden der Zusammenhang körperlicher Verausgabung im Fitnessstudio, beim Ballett und beim exzessiven Tanz in der Disco, das Ideal des Androgynen, die Magersucht, die Sprache von Magazinen und Alltagswendungen ("Du verdienst was Besseres als diesen Typen / diese Tusse"), schließlich die "Antropomorphose des Kapitals". Was sich in den hellsichtigeren Passagen abzeichnet, ist eine soziopolitische Körpertheorie: die Frage, wie ein ökonomisches System in das Fühlen und in die Form von Körpern einsickert.
Tiqqun versucht, eine neue politische Soziologie in Pamphletform zu pressen, wobei das Aphoristische und die endlose Wiederholung marxistischer Entfremdungstheoreme nach vierzig Seiten ordentlich nerven - eben weil keine konzise Theorie daraus wird.
Sowohl die "Grundbausteine" als auch der "Aufstand" zerfallen in zwei Teile: die Analyse einer Gesellschaft, die von Abschottungshysterien dominiert wird und das Ideal der Solidargemeinschaft weitgehend aufgegeben hat. Was, als Lösung der sozialen Misere, aus diesen oft sehr präzisen, brillant formulierten Beobachtungen folgt, ist das Ideal der sich selbst verwaltenden Landkommunen - eine seltsam retroaktive Phantasie, die das Muffige des Dorfs weiträumig ausblendet.
Auch das "unsichtbare Komitee" analysiert Musik, Architektur und Design, Bildung und Ernährung, ein Schulsystem, das auf eine Welt vorbereitet, in der ",autonom werden' ein Euphemismus ist für ,einen Chef gefunden haben und Miete bezahlen'", die "Sternchen des neuen französischen Chansons, wo das Kleinbürgertum seine Gemütszustände seziert" und die Aufteilung der Städte in "immer undurchlässigere Zonen". Und auch hier folgt auf die kluge Analyse ein deprimierend kindischer Lösungsvorschlag (Sabotage! Leben ohne Arbeit! Ernährung durch Ladendiebstahl!).
Nicht nur der Ton dieser Schriften, auch die Zielvorstellung erinnert an die Pamphlete der Situationistischen Internationale - einem 1957 gegründeten, linksradikalen Zusammenschluss europäischer Künstler, zu der Utopisten wie Constant, aber auch der spätere Mitgründer der Kommune 1 und Antisemit Dieter Kunzelmann gehörten, der aber wegen "Nationalsituationismus" ausgeschlossen wurde. Wie bei den Situationisten steht bei den neuen Autorenkollektiven die Abschaffung von Lohnarbeit und sozialen Hierarchien am Ende der geforderten Revolte. Die Situationisten forderten, Bedingungen für neue Möglichkeiten menschlichen Zusammenseins zu schaffen, die "Herstellung von Situationen", in denen das Leben selbst zum Kunstwerk werden sollte. Vielleicht liegt es an dieser Nähe, dass die französischen Pamphlete, weit über ein globalisierungskritisches Attac-Milieu hinaus, auch in Architekturzeitschriften und Ausstellungskatalogen auftauchen und, wie einst der Existentialismus, den Hintergrundton eines kollektiven Lebensgefühls abgeben.
In der französischen Gegenwartskunst findet das kommunardistische Ideal großen Widerhall. Der 1980 geborene Cyprien Gaillard, der mit Bildern von Banlieues bekannt wurde, hat in Berlin, in den Kunst-Werken, eine Art Proberaum dieser anderen Form von Gesellschaft aufgebaut: Die Ausstellungsbesucher dürfen auf einer Pyramide aus Bierkartons herumklettern und das Bier leer trinken, sie sitzen dort stundenlang und reden. Für die einen ist diese Pyramide "ein Raum, in dem eine andere Form von Gemeinschaft, von Öffentlichkeit" entstehe, ein Museion, in dem man schaut und staunt und redet, in der Gemeinschaft nicht durch Konsumhandlungen gerahmt werde - wenn man den ausgiebigen Konsum von Alkohol nicht dazurechnet -, ein Vorschein einer kommenden Gesellschaft, ein Antiraum, dessen soziale Dynamik aufs Leben draußen abstrahle. Für die anderen ist sie nur ein Surrogat für das, was draußen, jenseits des Museums, uneingelöst bleibe, ein Ort, an dem man das Bewusstsein des unerfüllten Lebens für einen Moment wegsaufe.
Auch die Hoffnung, dass die Kunst zum Trainingslager einer Gegengesellschaft werden möge, in der "öffentlich sein" sich nicht auf einen Einkaufsbummel mit Espresso und anschließendem Kinobesuch beschränkt, hat ihre Wurzeln in der französischen Philosophie. In einem unüblich schwärmerischen und metaphernfreudigen Text schrieb Gilles Deleuze: "Ein Monument feiert nicht etwas, das sich ereignet hat, sondern vertraut dem Ohr der Zukunft die fortbestehenden Empfindungen an: das stets wiederkehrende Leiden der Menschen, ihren immer wieder aufflammenden Protest." Die "Aufgabe aller Kunst" sei es, "den Affektionen die Affekte, den Meinungen die Empfindungen zu entreißen - mit Blick, so ist zu hoffen, auf jenes Volk, das noch fehlt."
Jacques Rancière - unter den gegenwärtigen französischen Philosophen der schärfste Kritiker einer Kunstszene, die ihn nichtsdestotrotz vergöttert - hat nicht nur eine giftige Bemerkung über Deleuze' seltsame "Zukunft, die Ohren hat" gemacht; er hat vor allem die Idee eines "fehlenden Volks" kritisiert - jener neuen Idealgemeinschaft, in der sich die Kunst im unentfremdeten Leben auflöst. Diese Idee, so Jacques Rancière, habe in der Geschichte nicht in eine erfüllte Gesellschaft, sondern einerseits in den sozialistischen Realismus und andererseits in die Produktidolatrie der Konsumgesellschaft geführt, in der jeder Körper als Kunstwerk und individualisierte Ware gestaltet wird (hier trifft sich Tiqqun wieder mit Rancière).
Grundlegender sind andere Fragen, die die Traktate aufwerfen: Wie, in welchen Hüllen und Räumen wir leben, und warum - und wieso es dazu keine Alternativen gibt. Warum etwa existieren nur zwei Bautypologien, die um eine etwa vierköpfige Familie herumkonzipierte, je nach Einkommen mehr oder weniger große "Wohnung" und das Haus vor der Stadt? Warum gibt es, obwohl es so viele Singles und Rentner gibt, die Wohnzellen nicht, die die französischen Utopiker Yona Friedman, Antti Lovag und Claude Parent erträumten - Räume, die das soziale Leben und das gemeinsame Wohnen, die Frage des räumlichen und sozialen Innen- und Außenraums offener, in vernetzten Wohnzellen organisieren wollten? Es wäre nicht erstaunlich, wenn im Zuge dieses Unbehagens an der Organisation des öffentlichen und des privaten Lebens die scheinbar obsolete Idee des Kibbuz als Lebensform (in urbanisierter, weniger ruraler Form) neu durchdacht würde.
Das größte Verdienst der neuen französischen Denkerkollektive ist, neben der Popularisierung einer politischen Soziologie, die Neubewertung der Utopien der sechziger Jahre - die Frage, welche offenen Enden dieser abgebrochenen Bewegung heute weitergesponnen werden können und müssten. Und es ist vielleicht kein Zufall, dass die Kunstwerke, die sich auf diesen Diskurs beziehen, aussehen wie eine Mischung aus der Schule von Athen und einer besetzten Pariser Universität im Mai 1968.
NIKLAS MAAK
Tiqqun: "Grundbausteine einer Theorie des Jungen-Mädchens". Übersetzt von Ronald Voullié. Merve, 120 Seiten, 13 Euro
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main