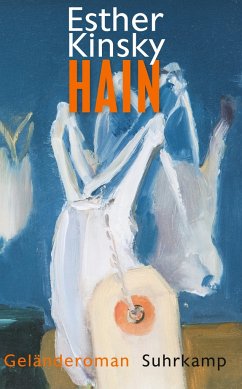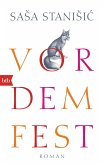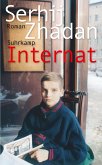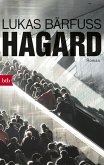Codierte Verlusterfahrung
Das Genre «Nature Writing» möchte Esther Kinsky nicht gelten lassen für ihr als «Geländeroman» apostrophiertes neues Prosawerk «Hain», das mit dem Preis der Leipziger Buchmesse 2018 prämiert wurde. Denn obwohl Landschaft und Natur darin einen breiten Raum einnehmen,
dienen sie ihr vornehmlich als meditativer Hintergrund für einen Prozess der Trauerbewältigung, in dem…mehrCodierte Verlusterfahrung
Das Genre «Nature Writing» möchte Esther Kinsky nicht gelten lassen für ihr als «Geländeroman» apostrophiertes neues Prosawerk «Hain», das mit dem Preis der Leipziger Buchmesse 2018 prämiert wurde. Denn obwohl Landschaft und Natur darin einen breiten Raum einnehmen, dienen sie ihr vornehmlich als meditativer Hintergrund für einen Prozess der Trauerbewältigung, in dem die Möglichkeiten hinreichender verbaler Verarbeitung von individuellen Wahrnehmungen und Erinnerungen für sie das eigentliche Thema bilden. Handlung, ein irgendwo hinführender Plot gar, sind so gut wie nicht vorhanden bei dieser in sich gekehrten Prosa, die von ihrer schieren Beschreibungskunst lebt wie kaum ein anderer Roman, den ich je gelesen habe.
«In Olevano Romano lebte ich auf einige Zeit in einem Haus auf einer Anhöhe», beginnt eine namenlose Ich-Erzählerin, die um ihren Lebenspartner trauert, ihre dreiteilige Erzählung, «zwei Monate und ein Tag nach M.s Beerdigung». Der Roman ist in 59 kurze Kapitel mit jeweils aus nur einem Wort bestehenden, wunderbar deskriptiven Titeln unterteilt. Eine mosaikartige Erzählung mithin, die sich jedoch hier nicht zu einem Ganzen fügt, vielmehr schlaglichtartig nur die Sinneseindrücke einer melancholischen Hinterbliebenen aneinanderreiht. Und es sind Reisen nach einem Italien, das nicht als Sehnsuchtsland dargestellt ist, ganz im Gegenteil. Wobei dann auch noch die Jahreszeiten so unspektakulär wie möglich gewählt sind, es ist frostig, neblig, stürmisch, regnerisch, verschneit, alles andere als das Wetterklischee von Bella Italia also. Im zweiten Teil wird als zeitlicher Einschub von Erinnerungen an die Kindheit erzählt, hauptsächlich an Italienreisen in den siebziger Jahren mit der Familie, wobei der italophile Vater mit seinem sehr speziellen Faible für etruskische Nekropolen dominant im Blickpunkt steht, Mutter und Bruder werden kaum erwähnt. Im dritten Teil «Comacchio» reist die einsame Ich-Erzählerin ins Podelta, und auch dort sind es wieder die Dinge, das Gelände, die weite Lagune, die erzählerisch im Fokus stehen. Die schmuddeligen Ortschaften werden ungeschönt in ihrer wenig einladenden Alltäglichkeit beschrieben, ihre Friedhöfe aber ziehen sie geradezu magisch an.
Alles ist Grau in Grau in diesem statisch wirkenden, farblosen Szenario, in dem Menschen allenfalls als Statisten vorkommen, in dem die Leere scheinbar grenzenlos ist und die eifrig fotografierende Ich-Erzählerin fast unsichtbar bleibt als Person. Das reizarme Milieu steigert ihre Fähigkeit zur Wahrnehmung ins beinahe Übersinnliche, selbst das kleinste Detail wird hier zum Ereignis, wobei der Erzählrhythmus allein ein wenig Bewegung in diese narrative Ödnis bringt. Über all dem liegt permanent die Trauer, verdüstert der Tod von M. und der des Vaters leitmotivisch das Geschaute, scheinbar Nebensächliche, das da ebenso präzis wie ausufernd beschrieben wird.
Als feinfühlig dargestellte Verlusterfahrung erfordert dieser erzählerisch fast schon asketische Roman einen ebensolchen, mithin geduldigen Leser, der aufnahmefähig ist für die zahlreichen subtilen Verweise und versteckten Symbole, aber auch für eine fein dosierte Intertextualität. Giorgio Bassani und dessen berühmter Roman «Die Gärten der Finzi-Contini» sind da vor allem zu nennen, wobei die Ich-Erzählerin diese Gärten vergeblich sucht im heutigen Ferrara, immerhin aber doch sein Grab findet. Pathetisch zwischen den Lebenden und den Toten schwebend, unentschieden zwischen Gegenwart und Vergangenheit oszillierend, ist Kinskys Hain der Ort, wo die Götter wohnen, von denen einer der übermächtige Vater ist. Vor den von ihm schwärmerisch beschriebenen Mosaiken in Ravenna stehend fühlt sie sich ihm seelisch zutiefst verbunden. Und man ahnt, dass die vordergründig spröde Erzählerin mit ihrer zuweilen fragwürdigen Semantik womöglich in ihrem «Geländeroman» eine Geheimsprache im Sinne Wittgensteins benutzt, für deren Code nicht jeder den passenden Schlüssel findet.