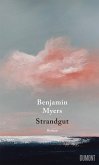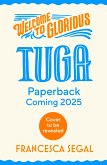Hannah Höch - eine queere Liebe, eine neue Zeit, eine Befreiung
Es sind die 20er Jahre des 20. Jahrhunderts, als Til auf Hannah trifft und Hannah auf Til. Eine gemeinsame Dekade beginnt. Erst in Den Haag, dann in Berlin verbringen die Künstlerin und die Autorin die letzten großen Partys und Momente zärtlicher Zweisamkeit. Doch von Sommer zu Sommer entpuppt sich das gemeinsame Leben und Schaffen zunehmend als Herausforderung, unter Druck gesetzt von der politischen Bedrohung durch den Nationalsozialismus. Behutsam und poetisch setzt Miku Sophie Kühmel in »Hannah« das Bild einer Liebe zusammen, die sich nicht nur an den Abgründen ihrer Zeit messen muss.
Es sind die 20er Jahre des 20. Jahrhunderts, als Til auf Hannah trifft und Hannah auf Til. Eine gemeinsame Dekade beginnt. Erst in Den Haag, dann in Berlin verbringen die Künstlerin und die Autorin die letzten großen Partys und Momente zärtlicher Zweisamkeit. Doch von Sommer zu Sommer entpuppt sich das gemeinsame Leben und Schaffen zunehmend als Herausforderung, unter Druck gesetzt von der politischen Bedrohung durch den Nationalsozialismus. Behutsam und poetisch setzt Miku Sophie Kühmel in »Hannah« das Bild einer Liebe zusammen, die sich nicht nur an den Abgründen ihrer Zeit messen muss.