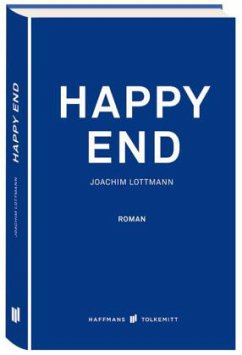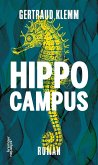Johannes Lohmer hat es geschafft. Jahrzehntelang hat er als Schriftsteller um Anerkennung gekämpft, jetzt ist er endlich im Literaturbetrieb angekommen: Die Leserschaft liebt ihn, das Feuilleton singt sein Lob. Zu allem Überfluss findet er in Wien auch noch die Frau seines Lebens. Doch das Glück ist der Tod jedes ernsthaften Schriftstellers, das weiß Lohmer nur zu gut. Er würde liebend gern aufs Schreiben verzichten, wenn es nicht einen ruf zu wahren gälte - vor Kollegen und Journalisten, vor dem Hausverlag und nicht zuletzt vor der Ehefrau. So beschließt Lohmer, den Schein des Schriftstellers zu wahren und macht sich daran, aufs Geratewohl einen Text in den Computer zu hacken. Was entsteht, ist ein grandios komischer Monolog wider Willen - über alles und nichts, über das Leben, die Liebe und die Literatur - sowie über seine verflixte Aufgabe, nebenbei einen würdigen Nachfolge-Preisträger für den renommierten Wolfgang-Koeppen-Preis zu bestimmen, was sich als schwieriger herausstellt als zunächst gedacht.
Bitte wählen Sie Ihr Anliegen aus.
Rechnungen
Retourenschein anfordern
Bestellstatus
Storno