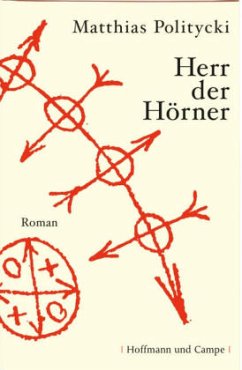Mit drei Zehnpesoscheinen in der Tasche macht sich der fünfzigjährige Broder Broschkus, erfolgreicher hanseatischer Bankier, auf in den schwarzen Süden Kubas, um dort eine Frau zu suchen, in deren abgründig grünen Augen er die Erleuchtung seines Lebens erfuhr. Er hofft, die Frau, von der er nicht einmal den Namen weiß, anhand der Notizen auf jenen drei Geldscheinen wiederzufinden.
Im Verlauf seiner Suche erkundet er erst das weltliche, zunehmend auch das religiöse Leben der Stadt: Hunde- und Hahnenkämpfe, Exhumationen und Hausschlachtungen üben eine rätselhafte Faszination auf ihn aus, zunehmend auch die afrokubanischen Kulte, denen man nicht nur in den Elendsvierteln anhängt. Ganz Santiago de Cuba scheint von etwas Dunklem beherrscht, über das zwar keiner reden will, auf dessen Spuren Broschkus nichtsdestoweniger immer häufiger stößt. Dass die gesuchte Frau damit in Verbindung stehen könnte, wird auch ihm bald klar; wie sehr sie freilich Werkzeug oder gar Inkarnation des Bösen ist, ahnt er nicht.
Im Verlauf seiner Suche erkundet er erst das weltliche, zunehmend auch das religiöse Leben der Stadt: Hunde- und Hahnenkämpfe, Exhumationen und Hausschlachtungen üben eine rätselhafte Faszination auf ihn aus, zunehmend auch die afrokubanischen Kulte, denen man nicht nur in den Elendsvierteln anhängt. Ganz Santiago de Cuba scheint von etwas Dunklem beherrscht, über das zwar keiner reden will, auf dessen Spuren Broschkus nichtsdestoweniger immer häufiger stößt. Dass die gesuchte Frau damit in Verbindung stehen könnte, wird auch ihm bald klar; wie sehr sie freilich Werkzeug oder gar Inkarnation des Bösen ist, ahnt er nicht.
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Rezensentin Sandra Kerschbaumer ist begeistert. Atmosphärisch mitreißend und spannend fand sie diesen Roman. Nicht nur, weil er mit Witz die Geschichte eines Hamburger Prokuristen erzähle, der in Kuba seine saturierte, westeuropäische Existenz abstreift, sondern auch weil das karibische Land selbst "berauschend schön" beschrieben sei. Matthias Polityckis Protagonist suche in der Karibik "die dionysische Lust", so die Rezensentin, die hier eine Verwandtschaft zu Friedrich Nietzsche sieht. Denn Politycki berufe sich eindeutig auf dessen Früh- und Spätwerk, wenn er dem schlaffen Westen die "ursprüngliche Vitalität" entgegensetze. Formal interessant findet die Rezensentin auch die Sprache des Romans, aus ihrer Sicht eine Mixtur aus Umgangssprache und Wortspielen sowie Wendungen, die sie ans achtzehnte Jahrhundert erinnern. Allerdings hat der Roman ihrer Ansicht nach auch Schwächen, die ihr besonders dort auffallen, wo der Autor die Moderne durch das vermeintlich Ursprüngliche zu ersetzen sucht.
© Perlentaucher Medien GmbH