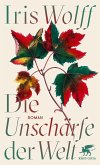Alma und Friedrich bekommen ein Kind, das keinen Schmerz empfinden kann. In ständiger Sorge um ihren Jungen, ist es vor allem Alma, die ihn unaufhörlich auf körperliche Unversehrtheit kontrolliert. Jeden Abend tastet sie das Kind ab, um keine Blessur zu übersehen. Und nichts fürchtet die junge Mutter mehr als die unsichtbare Verletzung eines Organs, die ohne ein Zeichen bleibt. Halt findet Alma bei ihrer Großmutter, die jetzt, hochbetagt und bettlägerig und nach lebenslangem Schweigen, zu erzählen beginnt: vom Aufwachsen im Krieg, von Flucht, Hunger und der Kriegsgefangenschaft des Großvaters. Mit dem Kind auf dem Schoß, das keinen Schmerz kennt, sitzt Alma am Bett der Schwerkranken, die sich nichts mehr wünscht, als ihren Schmerz zu überwinden. Und in den Geschichten der Großmutter findet sie eine Erklärung für jene scheinbar grundlosen Gefühle der Schuld, der Ohnmacht und der Verlorenheit, die sie ihr Leben lang begleiten.
Wie wird ein Kind zum Menschen, zu einem mitfühlenden sozialen Wesen, wenn es die Verwundbarkeit nicht kennt? Wenn es nicht versteht, wie sehr etwas wehtun kann? In eindringlichen Bildern erzählt Valerie Fritsch von einem Trauma, das über die Generationen weiterwirkt, sie lotet die Verletzlichkeit des Menschen aus und fragt nach dem Wesen des Mitgefühls, das unser aller Leben bestimmt.
Wie wird ein Kind zum Menschen, zu einem mitfühlenden sozialen Wesen, wenn es die Verwundbarkeit nicht kennt? Wenn es nicht versteht, wie sehr etwas wehtun kann? In eindringlichen Bildern erzählt Valerie Fritsch von einem Trauma, das über die Generationen weiterwirkt, sie lotet die Verletzlichkeit des Menschen aus und fragt nach dem Wesen des Mitgefühls, das unser aller Leben bestimmt.
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
In einer Doppelrezension bespricht Marie Schmidt zwei Romane, die sich mit dem Nichtvergehen eines Leids beschäftigen, das aus der Nachkriegszeit rührt. Schmidt gefällt, wie Valerie Fritsch das Statische, beinahe Fühllose der älteren Generation, die den Krieg erlebt und gemacht hat, in Sprache gießt. Auf verhaltene Weise ist die Kritikerin überzeugt von den Metaphern des Romans - zum einen in dem tatsächlich gefühllosen Urenkel, der das tiefe Hineinragen der Verdrängung in die Generationenfolge abbilde. Zum anderen ist für die Rezensentin auch die Reise der Enkelin-Familie nach Sibirien, Ort der Kriegsgefangenschaft des Großvaters, als "elegischer" Abschluss eine kräftige Aussage.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»In Valerie Fritschs Prosa ist etwas von der kindlichen Verletzlichkeit und dem Erstaunen lebendig, die man sich irgendwann abtrainiert, um überleben zu können.« Juliane Liebert DIE ZEIT 20200716