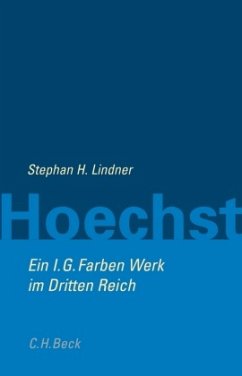Das vorliegende Buch untersucht die Geschichte des Werkes Hoechst als Teil des I.G. Farben Konzerns im Dritten Reich. Auf der Grundlage umfangreicher Archivrecherchen widmet sich der Autor der Frage nach dem Verhältnis von Werksleitung und Belegschaft zur NSDAP und ihren Organisationen. Ein besonderes Augenmerk legt er dabei auf die Frage nach den Handlungsspielräumen einer von Staat und I.G. Farben gleichermaßen beeinflußten Werksleitung.
1925 schlossen sich die drei führenden Unternehmen der deutschen chemischen Industrie - BASF, Bayer, Hoechst - und einige kleinere Chemieunternehmen zur I.G. Farbenindustrie AG zusammen. Die I.G. Farben wurden wie kaum ein zweiter Industriekomplex zum Synonym für die Verstrickung der Industrie in die Verbrechen des "Dritten Reiches". Stephan Lindner untersucht die Reaktionen der Hoechst Werke (als Teil der I.G. Farben) auf die neuen politischen Verhältnisse. Er kann zeigen, daß Leben und Arbeiten bei Hoechst unter dem Nationalsozialismusvon Anpassung, Ausgrenzung und Verfolgung gekennzeichnet war. Dabei behandelt er die zentrale Frage, inwieweit das Werk, seine Manager und Mitarbeiter mit dem neuen Regime, seinen Vertretern und Organisationen verbunden und in deren Verbrechen involviert oder gar aktiv an solchen beteiligt waren. Der Autor schildert dabei auch die dunkelsten Kapitel des Werkes: das Verhalten gegenüber seinen jüdischen oder als Juden geltenden Mitarbeitern, den sog. "Fremdarbeitern" sowie die Beteiligung des Unternehmens an Menschenversuchen in Konzentrationslagern.
1925 schlossen sich die drei führenden Unternehmen der deutschen chemischen Industrie - BASF, Bayer, Hoechst - und einige kleinere Chemieunternehmen zur I.G. Farbenindustrie AG zusammen. Die I.G. Farben wurden wie kaum ein zweiter Industriekomplex zum Synonym für die Verstrickung der Industrie in die Verbrechen des "Dritten Reiches". Stephan Lindner untersucht die Reaktionen der Hoechst Werke (als Teil der I.G. Farben) auf die neuen politischen Verhältnisse. Er kann zeigen, daß Leben und Arbeiten bei Hoechst unter dem Nationalsozialismusvon Anpassung, Ausgrenzung und Verfolgung gekennzeichnet war. Dabei behandelt er die zentrale Frage, inwieweit das Werk, seine Manager und Mitarbeiter mit dem neuen Regime, seinen Vertretern und Organisationen verbunden und in deren Verbrechen involviert oder gar aktiv an solchen beteiligt waren. Der Autor schildert dabei auch die dunkelsten Kapitel des Werkes: das Verhalten gegenüber seinen jüdischen oder als Juden geltenden Mitarbeitern, den sog. "Fremdarbeitern" sowie die Beteiligung des Unternehmens an Menschenversuchen in Konzentrationslagern.

Das I.G.-Farben-Werk Hoechst - Eine kritische Aufarbeitung
Stephan H. Lindner: Hoechst - Ein I.G.-Farben-Werk im Dritten Reich. Verlag C. H. Beck, München 2005, 352 Seiten, 34,90 Euro.
Die I.G. Farbenindustrie AG, die in diesem Buch aus der Sicht eines großen Werkes beleuchtet wird, war eine der spektakulärsten Unternehmensgründungen in Deutschland. Mit Blick auf die Marktstellung großer amerikanischer Chemiekonzerne wie DuPont hatten sich 1925 die deutschen Chemieunternehmen BASF, Bayer, Hoechst, Agfa, Cassella, Kalle sowie Weiler ter-Meer und Griesheim-Elektron zur Interessen-Gemeinschaft Farbenindustrie, kurz I.G. Farben, zusammengeschlossen. Damit entstand nicht nur Deutschlands größtes Unternehmen, sondern auch der viertgrößte Privatkonzern der Welt.
Der Chemiegigant hatte 1943 mehr als 4 Milliarden Reichsmark Umsatz, beschäftigte 330 000 Mitarbeiter, steuerte rund 210 deutsche und etwa 500 ausländische Tochter- und Beteiligungsfirmen. Dazu war der Konzern im In- und Ausland mit Großunternehmen durch Verträge und Kartellabkommen verflochten. Rund 9000 deutsche und 30 000 ausländische Patente dokumentierten seine Innovationskraft. Noch heute vermittelt das I.G.-Farben-Hochhaus, der Monumentalbau am Frankfurter Grüneburgpark, einen Eindruck von der wirtschaftlichen Macht, die sich hier ballte.
Nach der Machtergreifung Hitlers 1933 versuchte das ohnehin als kapitalistisch-jüdisch verschriene Unternehmen Distanz zum Regime zu wahren, seine jüdischen und regimekritischen Mitarbeiter zu schützen und die Kontrolle über den Konzern zu behalten. Doch der politische Druck wuchs, die NS-Partei gewann Einfluß in den Betrieben, und es winkten im Zeichen der Autarkie- und Aufrüstungspolitik Hitlers gute Geschäfte. Das führte zur allmählichen Anpassung. Die jüdischen Mitarbeiter und Aufsichtsräte mußten gehen. Die I.G. Farben produzierte synthetischen Kautschuk für Reifen (Buna), Benzin aus Braunkohle in den Leuna-Werken, Kunstfasern, Munitionsrohstoffe und in einer Beteiligungsfirma das Giftgas Zyklon B, das die SS später zur Judenvernichtung einsetzte. Von den 330 000 Beschäftigten waren im Krieg bis zur Hälfte Fremdarbeiter, Zwangsarbeiter und KZ-Häftlinge, von denen 30 000 beim Aufbau des I.G.-Werks Auschwitz und danach starben. In den besetzten Gebieten verleibte sich die I.G. Farben systematisch Betriebe und Unternehmen ein. Angesichts dieser Verstrickung in Hitlers Politik und Verbrechen wurde der Konzern von den Siegermächten aufgelöst. 23 führende Manager wurden vor einem amerikanischen Militärgericht angeklagt, 13 davon verurteilt.
Der Historiker Stephan Lindner, der am Zentralinstitut für Geschichte der Technik an der TU München lehrt, schildert in seinem Buch diese Zeit detailliert aus der Sicht des Werkes in Frankfurt-Höchst. Er analysiert sehr überzeugend, wie sich der Nationalsozialismus in einem solchen überschaubaren Bereich auswirkte, wie sich die Werksleitung im Spannungsfeld zwischen Konzerninteressen, Staatseinfluß und Parteiideologie verhielt und wie einzelne Mitarbeiter handelten. Es ist ein wichtiges Buch über den Unternehmensalltag im Dritten Reich. Zugleich wird hier erstmals die Geschichte der inzwischen im Sanofi-Aventis-Konzern aufgegangenen Farbwerke Hoechst in der Nazi-Zeit kritisch aufgearbeitet. Wie in vielen anderen deutschen Unternehmen auch war das vorher nicht (wie in der Festschrift von 1963) oder nur unzulänglich (wie im Buch des früheren Hoechst-Pressechefs Ernst Bäumler "Die Rotfabriker") möglich. Erst unter einer neuen Managergeneration mit dem damaligen Vorstandsvorsitzenden Jürgen Dormann an der Spitze wurden die Archive geöffnet.
Lindners Buch ist eine nicht nur kritische, sondern auch von Verständnis für Zeitumstände und Zwänge geprägte Darstellung, die in der moralischen Beurteilung indes keine Zweifel läßt. So zeigt Lindner, wie Manager zu willfährigen Helfern des Regimes wurden, wie Karrieresucht und Opportunismus, politischer Zwang, unangebrachte Pflichtgefühle in einem verbrecherischen Krieg und ideologischer Fanatismus zum Verrat an zuvor gültigen ethischen Normen führten. Er erwähnt jedoch auch, wie Führungskräfte - zum Beispiel bei der Vertreibung der jüdischen Mitarbeiter - vorhandene Spielräume für ein Minimum an Menschlichkeit nutzten.
Besonders verdienstvoll ist das Kapitel über den Umgang mit der Vergangenheit nach 1945. Es belegt, wie bis in die sechziger Jahre verschwiegen und beschönigt wurde, und ebenso, wie in der Politik die Kontinuität der Eliten erhalten blieb. Das Hitler-Regime, das freilich von der Mehrheit der Bevölkerung getragen worden war, galt als der einzige Schuldige. Eine Mitverantwortung der Führungskräfte sah man nicht oder wollte man nicht sehen und leugnete sie auch. Lindner führt damit jüngeren Generationen die Konflikte der Nazi-Zeit und danach noch einmal plastisch vor Augen. Er macht zumindest erklärbar, wenn auch nicht verstehbar, warum in weiten Teilen der deutschen Industrie nach 1945 so hartnäckig geschwiegen wurde. Ein interessanter Stoff für den Schulunterricht.
JÜRGEN JESKE
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Als "beeindruckende Studie" würdigt Jörg Später diese Arbeit über das I.G. Farben Werk von Hoechst im Dritten Reich, die der Wirtschaftshistoriker Stephan H. Lindner im Auftrag von Hoechst, verfasst hat. Die Schilderung der skrupellosen Komplizenschaft von Hoechst findet er "quellennah und detailliert". Linder belege, wie tief die NS-Ideologie das Management des Werks durchdrungen hatte, und zeige darüber hinaus das Bemühen der leitenden Direktoren nach dem Krieg auf, den "Opfern" der Entnazifizierung, nicht etwa den Opfern des NS-Regimes, zu helfen. Einen Schwerpunkt des Buches sieht Später in der Darstellung der Nazifizierung des Werkes in den 30er Jahren. Verstärkte Aufmerksamkeit schenke Linder zudem den "Fremdarbeitern" sowie dem Thema Medikamente und Menschenversuche. Später merkt an, dass Peter Hayes, der führende Historiker der IG-Farben-Geschichte, nach der Lektüre von Lindners Studie angekündigt habe, seine Interpretation, wonach sich die IG Farben gegenüber den Nazis weitgehend reaktiv verhalten hätten, zu überdenken. "So widerlegt", resümiert der Rezensent, "dieses akribisch recherchierte Buch die geläufige Meinung, der Nationalsozialismus sei doch längst erforscht".
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH