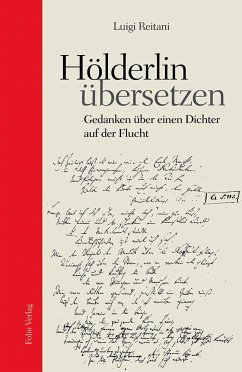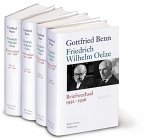Von der Macht einer Sprache, deren Reiz uns noch immer dazu verführt, sie in unser Leben zu übertragen - Hölderlin zum 250. Geburtstag. In sieben fulminanten Essays untersucht der renommierteste italienische Hölderlin-Experte und -Übersetzer das vielschichtige Werk eines Dichters, der uns mit seinen sprachlichen Gebilden noch immer fasziniert und der in unser Leben übersetzt zu werden verlangt. Reitani widerlegt das Vorurteil, wonach Hölderlin außerhalb der deutschen Sprachgemeinschaft kaum zu verstehen sei, im Gegenteil: Hölderlins sprachliche Komplexität, seine lyrische Kunst fordert geradezu zur unerschrockenen Auseinandersetzung der Philologen und Übersetzer heraus.

Luigi Reitani übersetzt Hölderlins Lyrik
Patmos ist eine unscheinbare Insel in der Ägäis, unweit der Küste von Kleinasien. Den Römern diente sie als Verbannungsort, und Johannes musste dort in unwirtlicher Fremde leben, als er jene Offenbarung empfing, die er den frühen Christen als Trostwort sandte und die zum letzten Buch des Neuen Testaments geworden ist. "Patmos" ist zugleich der Titel einer Hymne, die Friedrich Hölderlin 1803 verfasste, als sein Weg in innere Entrückung wie auch äußere Zerrüttung fortschreitend erkennbar wurde.
Diese Hymne, längst eins der bekanntesten Gedichte dieses Autors, besingt einen Moment des Aufbruchs zu einer plötzlichen Reise, eine Entführung geradezu, die den Sänger aus der vertrauten Welt hinausreißt und in eine wundersam wirkende Fremde versetzt. Als wollte er für diese Reise Schutz erflehen, bittet er um Flügel: "O Fittiche gib uns, treuesten Sinns / Hinüberzugehn und wiederzukehren." Eine Bitte, die mit dem Übergang in ein unbekanntes Drüben gleich schon die gegenläufige Bewegung vorwegnimmt und Sorge trägt, dass auch die Wiederkehr gelinge. Was aber meint hier "treuesten Sinns"? Zielt der Ausdruck auf das Sinnliche oder eher auf Gesinnung? Und was hieße dabei jeweils "treu"?
Solche Fragen geben Luigi Reitani Anstoß, sich Gedanken über Hölderlin zu machen, die diesem deutschen Dichter vom Standpunkt eines Drüben nachspüren, konkret: vom Erfahrungsstandpunkt eines italienischen Übersetzers, der Hölderlins Texte seit langem in eine fremde Sprachwelt führt. Gerade das Italienische erscheint dafür vielversprechend, denn immerhin, schreibt Reitani, hatte Hölderlin in Jahren der Umnachtung seinen deutschen Namen abgelegt und sich stattdessen mit einer Reihe klangvoller italienischer Künstlernamen - Scardanelli, Scarivari, Rosetti, Buonarroti - neu erfunden. Was geschieht, wenn sich sein "treuester Sinn" auf eine solche Reise einlässt?
Die italienischen Übersetzungen der "Patmos"-Hymne wählen für den Ausdruck einhellig das Herz und sprechen von "con il cuore più fedele". Michael Hamburger dagegen, der sie ins Englische übersetzt hat, wählt an dieser Stelle das Wort "mind", das auch "Geist", "Verstand", "Seele" und "Gedanke" heißen mag. Für Reitani ist die Vielfalt der Varianten kein Verlust, sondern ein emphatischer Gewinn, der sich einstellt, wenn das Übersetzen unserer Gedichtlektüre ein weiteres Bedeutungsspektrum öffnet: "Es ist, als ob der ganze Mensch da wäre, mit Kopf und Herz und Sinnen, bei dieser Reise hinüber und zurück." Der treueste Sinn wäre jener, der erst ins Fremde hinübergegangen und dann verfremdet wiedergekehrt ist. Mit immer neuen Varianten umspielen seine Essays diesen Punkt.
Dabei weiß er, was in Rede steht. In zwei umfangreichen Bänden hat Reitani Hölderlins Gesamtwerk ins Italienische übersetzt, zweisprachig herausgegeben und ausführlich kommentiert. Zudem ist er eine bekannte Instanz internationaler Kulturvermittlung, lehrt deutsche Literatur an der Universität Udine und leitete bis zum vergangenen Jahr das italienische Kulturinstitut in Berlin. Die acht Essays (bis auf einen schon verstreut in diversen Fachorganen publiziert), die er zum Hölderlin-Jubiläum zusammengestellt hat, sind allen Lyriklesern wunderbar zugänglich. Obschon aus jedem die Kenntnis des Experten spricht, trägt Reitani die Gelehrsamkeit mit leichter Hand und nutzt sie subtil zur Fährtensuche, um uns einzuladen, Hölderlins Wegen ins Unbekannte nachzugehen.
Dazu erweist das Übersetzen sich als Kompass, und dies nicht nur, weil Hölderlin selbst Übersetzer war, der unserer Sprache - beispielsweise mit den Sophokles-Tragödien - bis dahin Unerhörtes und Gewagtes zugemutet hat. Alle Übersetzerarbeit zielt aufs Reisen und braucht Mut, denn sie will Sinn entführen, um ihm in entlegenen Welten neue Wirkung zu verschaffen. Deshalb geht es ihr nicht notwendig darum, die Spuren dieses Fremden auszumerzen und alle Sprache ins Vertraute heimzuholen, sondern vielmehr das wirksam zu machen, was sich solcher Anverwandlung widersetzt. So mag beim Übersetzen wie überhaupt beim Lesen starker Lyrik die Offenbarung darin liegen, dass wir nie zu Ende kommen. Das Trostwort Hölderlins könnte darin liegen, uns zum Widersinn und Aufbruch in ein Unbekanntes anzustiften. Hölderlin übersetzen, das zeigen uns Reitanis Lesehilfen, ist ein Weg zu seinem treuesten Sinn.
TOBIAS DÖRING
Luigi Reitani: "Hölderlin übersetzen". Gedanken über einen Dichter auf der Flucht.
Folio Verlag, Wien 2020.
108 S., geb., 20,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main