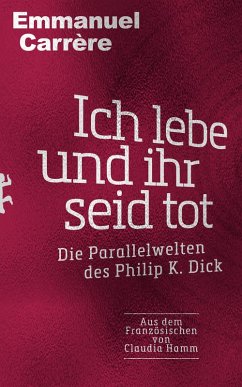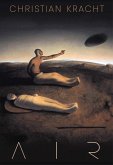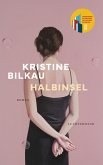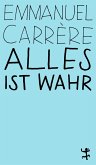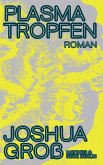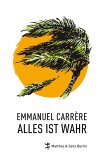Philip K. Dick (1928-1982) gehört zu den einflussreichsten US-amerikanischen Autoren des 20. Jahrhunderts. Seine Romane und Kurzgeschichten wurden nicht nur vielfach verfilmt - Blade Runner, Total Recall und Minority Report waren internationale Kinoerfolge -, sondern dienten unzähligen anderen Autoren, darunter Emmanuel Carrère, als Inspirationsquelle. Zeit seines Lebens trieb Dick die Frage um, welche inneren und äußeren Mächte unser Denken, Fühlen und Handeln lenken. In den phantastischsten Szenarien malte er aus, welche verheerenden Auswirkungen es hat, wenn ein Mensch sich dessen, was er glaubt, sieht oder weiß, nicht mehr sicher sein kann, ja wenn er sich fragen muss, ob er überhaupt ein Mensch ist. Seine 1977 in einer legendären Rede geäußerte Mutmaßung, wir lebten in der Simulation einer Künstlichen Intelligenz, lässt sich in ihrer prophetischen Kraft erst heute wirklich ermessen. Doch waren seine mystischen Visionen und seine Überzeugung, von FBI und KGB beschattet zuwerden, nur auf drogeninduzierte Psychosen zurückzuführen, oder »erinnerte« er sich wirklich an eine parallele Gegenwart, die anderen verborgen war?
Emmanuel Carrère erzählt Dicks Leben vom Plattenverkäufer bis zum selbsternannten Messias in einem Amerika, das schon vor Jahrzehnten von Paranoia und Spaltung geprägt war, als leichtfüßigen, hypnotischen Roman. Er legt dabei erstaunliche Lesarten für die Gegenwart und die aktuelle Rolle von Technik und Macht frei und wirft existenzielle Fragen auf, die bis zu den Wurzeln der westlichen Zivilisation reichen.
Emmanuel Carrère erzählt Dicks Leben vom Plattenverkäufer bis zum selbsternannten Messias in einem Amerika, das schon vor Jahrzehnten von Paranoia und Spaltung geprägt war, als leichtfüßigen, hypnotischen Roman. Er legt dabei erstaunliche Lesarten für die Gegenwart und die aktuelle Rolle von Technik und Macht frei und wirft existenzielle Fragen auf, die bis zu den Wurzeln der westlichen Zivilisation reichen.