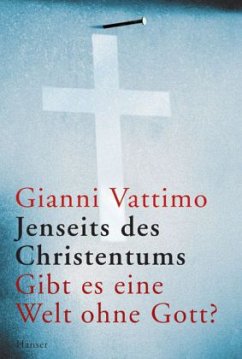Gibt es einen postmodernen Gott? Nietzsches Botschaft, Gott sei tot, ist Allgemeingut geworden. Aber wer ist an seine Stelle getreten? Der Philosoph Gianni Vattimo plädiert für eine neue Form der Christlichkeit: es könnte ein christlicher Glaube sein, der sich von allen Dogmen befreit hat.
"Ein leidenschaftliches Plädoyer für den persönlichen Offenbarungsglauben ..." (Die Zeit)
"Italiens postmoderner Chefphilosoph fordert ein neues, besseres Christentum." (Süddeutsche Zeitung)
"Italiens postmoderner Chefphilosoph fordert ein neues, besseres Christentum." (Süddeutsche Zeitung)

Gianni Vattimo ist für ein Christentum jenseits des Christentums
Keine Religion hat seit ihren Anfängen so sehr darauf geachtet, eine Allianz mit der Philosophie zu schmieden, wie das Christentum. Was Kritikern als die zentrale Verfälschung des Christlichen gilt - die von den Kirchenvätern vollzogene Synthese des biblischen Glaubens mit dem hellenischen Geist -, war ursprünglich als missionarischer Akt verstanden worden: als Dolmetschung des Christlichen nach außen, in einer auch Nichtgläubigen verständlichen philosophischen Sprache.
Insoweit, sagt der italienische Philosoph Gianni Vattimo, solle alles beim alten bleiben: Das Christentum solle auf seine philosophische Anschlußfähigkeit auch künftig nicht verzichten. Doch welche Welten trennen Vattimo von den Kirchenvätern! Während diese philosophisch auf neuplatonische Ontologie setzten, schlägt jener der Religion das Bündnis mit der postmodernen Dekonstruktion vor. Statt auf Aristoteles und Platon zu bauen, müsse man lernen, mit der Geistprophetie des Joachim von Fiore, mit Nietzsches Tod Gottes und mit Heideggers Ereignislehre auszukommen, sagt Vattimo. Daß man auf diesem Wege im Ergebnis zu einem historisch "anderen" Christentum gelangt, zu einem Christentum "jenseits des Christentums" (so der Buchtitel) - ebendies wird von Vattimo nicht bloß in Kauf genommen, sondern erwünscht. Welches Christentum wünscht sich Vattimo? Es ist ein Christentum der "Liebe" und "Freiheit", durchgängig spiritualisiert, vom Institutionellen entkoppelt, gruppiert um den "Leitfaden der Schwächung", wie er sich sowohl in der Krippe von Bethlehem als auch im Fragmentarischen postmodernen Philosophierens ausdrücke. Vattimo will ein Christentum, dessen Formgehalt sich als kontingenter Ausdruck religiöser Ursymbolik versteht, dem es weniger um "Inhalte" als um religiöse "Erfahrung" geht. So werde es möglich, "der Lehre Joachims von Fiore ein Bild postmoderner Religiosität einzuhauchen". Es werde eine Religiosität des "dritten Zeitalters" sein (hier: die Postmoderne), welche das "antimetaphysische Prinzip" zum Sprechen bringe, "das von Christus in die Welt eingeführt worden ist".
Das Interessante an Vattimos Buch sind nicht die theologischen Postulate. Die Kirchengeschichte ist reich an spiritualistischen Avancen, und natürlich arbeitet sich auch die neuere Theologie an derartigen Vorschlägen im Zeichen von Weltethos, Kirchenkritik und mystischer Zukunft des Christentums ab. Doch der theologische Diskurs hat es in dieser Frage nie geschafft, von der Philosophie aufgegriffen zu werden, er zirkuliert in sich selbst, welcher Philosoph zitiert schon Karl Rahner? Vattimo - und das eben ist das Interessante an seinem Buch - macht die Zukunft des Christentums zu einem genuin philosophischen Thema. Damit setzt er die entscheidende Frage frei: Ist die Metaphysik der Griechen konstitutiv für das Christentum? Oder ist sie bloß eine historische Opportunität gewesen, eine Philosophie, die austauschbar ist, heute also ohne theologische Verluste durch die postmoderne Dekonstruktion ersetzt werden könnte?
Etienne Gilson hat auf den eigentümlichen Umstand aufmerksam gemacht, daß Platon und Aristoteles trotz ihres philosophischen Monotheismus religiös Polytheisten geblieben sind. Philosophisch haben sie Gott als absoluten Weltgrund erkannt, religiös hielten sie ihn jedoch weiterhin für unansprechbar im polytheistischen Sinne. Den biblischen Glauben verständlich zu machen hieß darum, einerseits auf die griechische Metaphysik zurückzugreifen (Gott als absoluter Weltgrund), andererseits über sie hinauszugehen (Gott offenbart sich als für den Menschen ansprechbar, ist nicht länger der unbewegte Beweger). Vattimo rührt, wenn er Christus als Antimetaphysiker hinstellt, an ein Paradox. Unstreitig ist Jerusalem nicht Athen, aber ohne Athen wäre Jerusalem Fragment geblieben. So kann man den "Leitfaden der Schwächung" auch anders auslegen: Das Christentum bindet seine Lehre, kein philosophisches Fragment neben anderen zu sein, an eine Philosophie unter anderen. Sie soll das Absolute in Worte kleiden, obwohl ihre Autorität als Philosophie keine absolute sein kann. Aristoteles ist ein Hauch der Geistesgeschichte.
Was philosophisch wie Dezisionismus aussieht - das lehramtliche Festhalten am die antike Metaphysik verarbeitenden Thomismus -, erklärt sich als theologische Verlegenheitslösung: Man hat nichts Passenderes gefunden, um den Namen Jahwes auf den Begriff zu bringen, als aus dem "Ich bin" der "Ich bin der Seiende" zu machen, als die zentrale Selbstaussage Gottes an etwas so Vorläufiges wie die Seinsphilosophie zu binden. Daß eine solche Entäußerung des Absoluten Risiken und Nebenwirkungen hat, scheint bereits im Gedanken der Inkarnation beschlossen. Jenseits des Christentums sucht man die schwache Nummer der Menschwerdung Gottes freilich vergebens. Statt dessen findet man den Absolutismus jener Fragmentphilosophien, für die Vattimo eine Schwäche hat.
CHRISTIAN GEYER
Gianni Vattimo: "Jenseits des Christentums". Gibt es eine Welt ohne Gott? Aus dem Italienischen von Martin Pfeifer. Carl Hanser Verlag, München 2004. 192 S., geb., 19,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
Der Turiner Philosoph Gianni Vattimo bleibt auch als Philosoph immer noch ein bisschen Theologe, bemerkt Martin Meyer und vergleicht ihn diesbezüglich mit Martin Heidegger. Mayer formuliert die Kernfrage von Vattimos neuem Essay so: Wie könnte ein Christentum beschaffen sein, das die absolute Wahrheit hinter sich gelassen habe und dennoch an den "Urformen seines Geistes" festhalte? Vattimos Gedankengängen haftet laut Meyer etwas Zirkuläres an, dennoch ergeben sich manchmal überraschende Ausblicke. Zum Beispiel gewinne Vattimo dem Begriff Säkularisierung eine "frische Bedeutung" ab, indem er darin nicht nur eine Profanisierung sakraler Inhalte, sondern auch eine "Erfüllung des Sakralen" im Geiste der Toleranz sieht. Ein bisschen zu viele freundliche und freundschaftliche Gesten sieht Meyer in Vattimos berühmten "schwachen Denken" sich manifestieren, das seines Erachtens nicht genügend mit der Ratlosigkeit anderer Theologen und Religionsphilosophen gerungen hat. Insofern habe Vattimos Sicht auf das Christentums - als einer der Gastfreundschaft und dem Dialog verpflichteten Haltung - eine Wendung ins Beschauliche genommen, merkt Meyer etwas unzufrieden an. Ob diese Art des "toleranten Spiritualität" den politischen Theologien und Fundamentalismen von heute standhalten könne, muss sich erweisen, setzt er zweifelnd hinzu.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH