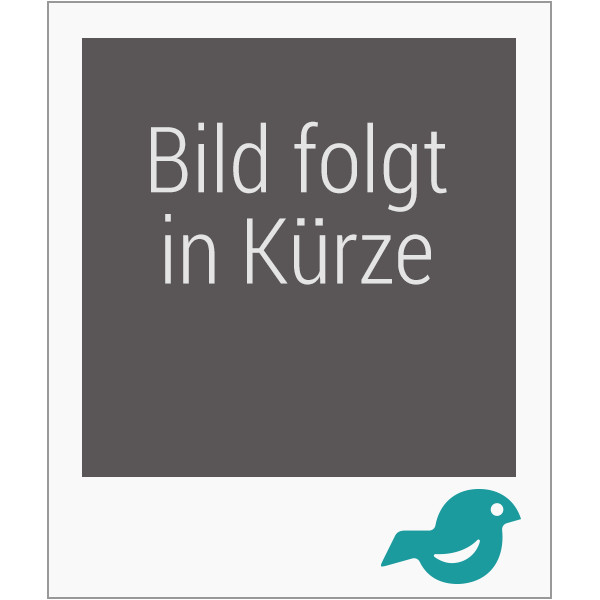Peter Schäfer befasst sich in einer allgemeinverständlichen Darstellung mit der vernichtenden Kritik des antiken (vor allem babylonischen) Judentums an der Person Jesu und der christlichen Botschaft. Er zeigt, wie sich die Mutterreligion mit den Mitteln subversiver Parodie gegen den Anspruch des Christen - tums als der neuen, das Judentum ablösenden Religion wehrt.
Jesus im Talmud gilt vielen Forschern als Oxymoron, kommt doch die Gründerfigur des Christentums wenn überhaupt, so nur in obskuren, zusammenhanglosen und über das Gesamtwerk verstreuten Passagen des Talmuds vor. Peter Schäfer unterzieht diese wenigen Passagen einer neuen Prüfung, indem er durch eingehende Exegese den jeweiligen Kontext aufdeckt, in den sie in die talmudische Diskussion eingebettet sind. Dabei geht es ihm nicht um die Rekon - struktion verschütteter Fakten über Jesus als vielmehr darum, die Ein - stellung des Talmuds zum Verhältnis zwischen Judentum und dem ent - stehenden Christentum zu erheben, die sich hinter diesen Passagen ver - birgt. Einige immer wiederkehrende Topoi wie Magie, Gotteslästerung, Götzendienst und sexuelle Verfeh - lungen ziehen sich wie ein roter Faden durch diese Texte und lassen sich – entgegen den bisherigen Erkennt - nissen – zu einer Grundstruktur verbinden, entlang der die Rabbinen (wenn auch in verhüllter Form) ihre Gegenerzählung zum Bericht des Neuen Testamentes vortragen. Schäfer sieht hierin die Kampfansage einer bedrohten Religion, die sich am An - fang der »Trennung der Wege« selbst - bewusst gegen ihre Heraus forderin, das Christentum, wehrt. Diese Gegen - erzählung lässt sich jedoch fast aus - schließlich im babylonischen Talmud nachweisen, da die Juden nur im sassanidischen Herrschaftsbereich relative Freiheit genossen, sie zu formulieren, während in Palästina die aufkommende christliche Herrschaft von Anfang an Freiheit und Gleichheit der Juden einschränkte.
This is a thorough investigation of the passages about Jesus in the rabbinic literature, mainly in the Babylonian Talmud. In his lucid and accessible book, Peter Schäfer examines how the rabbis read and used the New Testa - ment to assert Judaism’s superiority over Christianity. The Talmudic texts focus on the virgin birth of Jesus, his behavior as a bad and frivolous disciple, his teachings, the healing capacities Jesus and his disciples possessed, the execution of Jesus and his disciples, and finally his punis h - ment forever in hell. The center of this critique of Jesus and his fate was Babylonia under Sassanian rule, quite in contrast to Palestinian Judaism, which was increasingly threatened by the dominant power of Christianity.
Jesus im Talmud gilt vielen Forschern als Oxymoron, kommt doch die Gründerfigur des Christentums wenn überhaupt, so nur in obskuren, zusammenhanglosen und über das Gesamtwerk verstreuten Passagen des Talmuds vor. Peter Schäfer unterzieht diese wenigen Passagen einer neuen Prüfung, indem er durch eingehende Exegese den jeweiligen Kontext aufdeckt, in den sie in die talmudische Diskussion eingebettet sind. Dabei geht es ihm nicht um die Rekon - struktion verschütteter Fakten über Jesus als vielmehr darum, die Ein - stellung des Talmuds zum Verhältnis zwischen Judentum und dem ent - stehenden Christentum zu erheben, die sich hinter diesen Passagen ver - birgt. Einige immer wiederkehrende Topoi wie Magie, Gotteslästerung, Götzendienst und sexuelle Verfeh - lungen ziehen sich wie ein roter Faden durch diese Texte und lassen sich – entgegen den bisherigen Erkennt - nissen – zu einer Grundstruktur verbinden, entlang der die Rabbinen (wenn auch in verhüllter Form) ihre Gegenerzählung zum Bericht des Neuen Testamentes vortragen. Schäfer sieht hierin die Kampfansage einer bedrohten Religion, die sich am An - fang der »Trennung der Wege« selbst - bewusst gegen ihre Heraus forderin, das Christentum, wehrt. Diese Gegen - erzählung lässt sich jedoch fast aus - schließlich im babylonischen Talmud nachweisen, da die Juden nur im sassanidischen Herrschaftsbereich relative Freiheit genossen, sie zu formulieren, während in Palästina die aufkommende christliche Herrschaft von Anfang an Freiheit und Gleichheit der Juden einschränkte.
This is a thorough investigation of the passages about Jesus in the rabbinic literature, mainly in the Babylonian Talmud. In his lucid and accessible book, Peter Schäfer examines how the rabbis read and used the New Testa - ment to assert Judaism’s superiority over Christianity. The Talmudic texts focus on the virgin birth of Jesus, his behavior as a bad and frivolous disciple, his teachings, the healing capacities Jesus and his disciples possessed, the execution of Jesus and his disciples, and finally his punis h - ment forever in hell. The center of this critique of Jesus and his fate was Babylonia under Sassanian rule, quite in contrast to Palestinian Judaism, which was increasingly threatened by the dominant power of Christianity.

Eigentlich müssten die deutschen Intellektuellen von diesem Buch elektrisiert sein. Denn seine Grundthese wird ihnen bekannt vorkommen. Die "Dialektik der Aufklärung" von Horkheimer und Adorno wurde in den frühen vierziger Jahren im amerikanischen Exil verfasst. Man findet in diesem Hauptwerk der neueren Kulturkritik eine Analyse, die zu den theologischen Wurzeln vordringen will: an die Stelle des "kristallhellen Gesetzes" des Alten Testaments habe das Christentum einen Götzen gesetzt.
Christus, so schrieben die Verfasser (aber vermutlich war es in diesem Fall Max Horkheimer, nicht der getaufte und konfirmierte Adorno), Christus also, "der fleischgewordene Geist, ist der vergottete Magier . . . Der Fortschritt über das Judentum ist mit der Behauptung erkauft, der Mensch Jesus sei Gott gewesen. Gerade das reflexive Moment des Christentums, die Vergeistigung der Magie ist schuld am Unheil." Den Ursprüngen dieser Vorstellung, die das Wunder zur Zauberei umdeutet, geht nun der in Princeton und an der Freien Universität Berlin lehrende Judaist Peter Schäfer nach ("Jesus im Talmud". Aus dem Englischen von Barbara Schäfer. Verlag Mohr Siebeck, Tübingen 2007. XVII, 308 S., br., 29,- [Euro]).
Schäfer versammelt die verschiedenen Aussagen des Talmud, die auf Jesus hinweisen. Dabei legt er seine philologischen Karten offen auf den Tisch; kühnere Hypothesen und gewagtere Lesungen, die er sich gelegentlich erlaubt, weist er als solche aus. In Kürze lässt sich seine These so zusammenfassen: Über Jesus spricht der Talmud zwar eher beiläufig, aber nicht selten, und durchweg in herabsetzender Tendenz. Solche Passagen sind indes nicht als historische Berichte über den wirklichen Jesus von Nazareth zu verstehen, vielmehr benutzen sie die Evangelien, um diese mit einer "Gegengeschichte" zu konterkarieren.
Diese Gegengeschichte war unausweichlich geworden, wenn sich das Judentum seiner selbst vergewissern wollte: "Es ist genau um die Zeit, als das Christentum sich von bescheidenen Anfängen zu seinen ersten Triumphen aufschwang, dass der Talmud (oder besser die beiden Talmude) das maßgebende Dokument derer werden sollte, die den neuen Bund zurückwiesen, die so hartnäckig darauf bestanden, dass sich nichts geändert hatte und dass der alte Bund weiter gültig war."
Eine Hauptquelle der talmudischen Polemik scheint aber, wenn man Schäfer folgt, auch die Schrift des spätantik-heidnischen Philosophen Celsus gewesen zu sein, bei dem einige der Topoi schon versammelt sind: Nach Celsus war Jesus die Frucht eines Ehebruchs, und die Flucht nach Ägypten, von der der Evangelien berichten, sei vielmehr zu dem Zweck unternommen, im eigentlichen Heimatland antiker Zauberei sich von ägyptischen Magiern einweihen zu lassen.
Was die Geburt Jesu angeht, so gibt der babylonische Talmud eine Mitteilung, die, so Schäfer, "wie ein schwaches und verzerrtes Echo" der Evangelien anmute, tatsächlich aber ein ambitionierter Gegenentwurf sei. Nicht beim Namen werde er genannt, sondern, rätselhaft als "Ben Stada" oder "Ben Pandera" bezeichnet. "War er", so die einschlägige Stelle im Zusammenhang, "der Sohn von Stada (und nicht ganz im Gegenteil) der Sohn von Pandera? Rav Chisda sagte: Der Ehemann war Stada, (und) der Liebhaber Pandera. (Aber war nicht) der Ehemann Pappos ben Jehuda und vielmehr seine Mutter Stada? Seine Mutter war (Miriam), (die Frau, die ihr) Frauenhaar lang wachsen ließ. Dies ist es, was man in Pumbeditha sagt: Diese ist abgewichen von (war untreu) ihrem Ehemann."
Das lange Haar steht hier für unziemlichen Lebenswandel. In knappster Form wird aus Jesus ein Bastard gemacht, verschärft noch durch die Herkunft von einem römischen Soldaten. Denn der Name "Pandera" scheint eben von Celsus ins Spiel gebracht worden zu sein, bei dem man liest, die Mutter Jesu habe von "einem Soldaten namens Panthera ein Kind bekommen". Damit ist der legitimierende Anspruch einer Abstammung aus dem Hause David polemisch zurückgewiesen.
Weitere Kapitel widmet Schäfer dem missratenen Sohn, dem frivolen Schüler, dem Toralehrer und den Heilungen. Entscheidend aber ist die talmudische Darstellung der Hinrichtung Jesu (nach b Sanh 43a): "(Am Vorabend des Sabbat und) am Vorabend des Passahfestes wurde Jesus von Nazareth gehängt. Und ein Herold ging 40 Tage vor ihm aus (und verkündete): Jesus von Nazareth wird hinausgeführt, um gesteinigt zu werden, weil er Zauberei praktiziert und Israel aufgewiegelt und (zum Götzendienst) verführt (hiddiach) hat." Schäfer weist auf die Diskrepanz zu den Evangelien hin, nach diesen wurde Jesus - römisch - gekreuzigt, nach dem Talmud - gemäß jüdischer Rechtsauffassung - gesteinigt und anschließend gehängt. Die Pointe des Talmud sei es, das Verfahren gegen Jesus wieder ganz dem Judentum zurückzugewinnen.
Schäfers Buch provoziert Berührungsängste, und dies dürfte der Grund dafür sein, dass es bislang in der deutschen Presse keiner Besprechung gewürdigt wurde.
LORENZ JÄGER
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Einen nüchternen Blick wirft Lorenz Jäger auf Peter Schäfers Untersuchung der Passagen über Jesus, die sich im Talmud finden. Die verschiedenen, auf Jesus Bezug nehmenden Aussagen des Talmud deute der Judaist als eine der jüdischen Selbstvergewisserung dienende "Gegengeschichte", die ein recht negatives Bild von Jesus ergebe. Jäger bescheinigt dem Autor, gelegentliche "kühnere Hypothesen" und philologisch "gewagtere Lesungen" auch als solche auszuweisen. Schäfers Interpretationen der entsprechenden Jesus-Stellen (Jesus als Bastard oder missratenen Sohn) referiert er, bezieht aber keine Stellung dazu. Sein Fazit: ein Buch, das "Berührungsängste provoziert".
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH