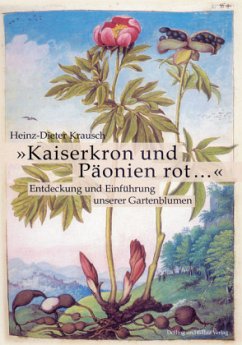Wer Reseda (Nordafrika) und Ranunkeln (Kleinasien), Sommerastern (China), Sommerphlox (Südtexas) und Strohblumen (Australien), Gladiolen (Kap) und Zinnien (Mexiko), Balsaminen (Ostindien), Dahlien (Chimborazo), Verbenen (Argentinien) und Sonnenblumen (Peru) pflanzt, der hat einen Weltgarten. Das haben wir häufig längst vergessen. Wir empfinden die von Reisenden, Botanikern und Pflanzensammlern aus fernen Ländern mitgebrachten Blumen inzwischen als bei uns beheimatet - ein Irrtum, den das Buch gründlich ausräumt. Die erste umfassende Darstellung erzählt in 250 Einzelkapiteln die Geschichte von mehr als 500 Arten der häufigsten Gartenzierpflanzen Mitteleuropas.Sie beschreibt ihr Heimatareal, ihre Entdeckung, Einführung und Ausbreitung in den Gärten Europas, ihre Weiterzüchtung und Kulturgeschichte und ihre Verwendung in Medizin, Volkskunde, Malerei und Dichtung. Die locker geschriebene Darstellung fußt auf eingehender Auswertung von Primärquellen in in- und ausländischen Bibliotheken und Gemäldesammlungen sowie der wissenschaftlichen Literatur. Erste oder sehr frühe und selten abgebildete Holzschnitte und Kupferstiche bereichern den Text und geben eine Vorstellung davon, wie bescheiden unsere zum Teil inzwischen üppigen Blumen einst in unsere Gärten kamen.

Historische Ausflüge zu den Ursprüngen unserer Zierblumen
Über die Blumen, die im Garten gedeihen, weiß der floristische Laie gewöhnlich kaum mehr zu berichten als die Freude, die er beim Blühen im Frühjahr oder Sommer versprürt. Doch jedes dieser Gewächse hat eine eigene faszinierende Geschichte, eine Ahnentafel gewissermaßen, über die man leider auch beim Gärtner oft nichts in Erfahrung bringen kann. Dabei sind zwischen Rasen und Häuserschluchten nicht selten Vertreter aller Kontinente und Epochen vertreten: Dahlien, die aus Amerika stammen, Pelargonien aus Südafrika, Sommerastern aus China oder die Dach-Hauswurz im nebenstehenden Bild, der von den Pyrenäen zu uns gelangt ist. Der Forscher Heinz-Dieter Krausch, einer der versiertesten Kenner der mitteleuropäischen Flora, hat die Abstammungsgeschichte von mehr als fünfhundert einheimischen Gartenblumen recherchiert und seine Erkenntnisse in einem beeindruckenden und verständlich geschriebenen Nachschlagewerk festgehalten. Der Autor verließ sich dabei nicht etwa auf Anekdoten, sondern durchforschte monatelang die Archive und Bibliotheken in ganz Mitteleuropa nach entsprechenden hiostorischen Quellen.
jom
Heinz-Dieter Krausch: "Kaiserkron und Päonien rot . . .", Dölling und Galitz Verlag, Hamburg 2003, 536 S., 49,80 Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Für eine kontemplative Lektüre in der dunklen Jahreszeit solle man sich den Titel vormerken, meint Stefan Rebenich. In einer Geschichte der Zierpflanzen Mitteleuropas lerne man, wo die eigene Lieblingsblume entdeckt wurde und welchen Weg sie nach Europa nahm. Um das Material für diese "Sozial- und Kulturgeschichte der europäischen Zierpflanzen" zusammenzutragen, hat der Autor viel gelesen, berichtet der Rezensent beeindruckt und betont begeistert, dass auch übergreifende kulturgeschichtliche Fragegestellungen behandelt werden: In "Einführung und Inkulturnahme" der Zierpflanze lernte der Rezensent, dass in der Renaissance der Pflanzentransfer globalisiert wurde und die neuen gefragten Statussymbole zum Beispiel nach dem Opiumkrieg von "professionellen plant hunters" aus China gebracht wurden. "Unverständlich" findet der Rezensent die Entscheidung des Verlages, das Buch mit Holzschnitten und Kupferstichen in "mäßiger Qualität" zu illustrieren, wo doch originalgetreue Illustrationen aus frühen Blumenbüchern besser gepasst hätten. Dennoch begrüßt er die Sammlung, da sie zum Weiterdenken einlade.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH