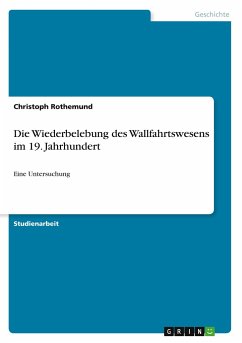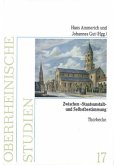Die Bischofsstuhlbesetzungen in zwei italienischen Kirchenprovinzen (Mailand und Salerno) von der Zeit des Pontifikates Innozenz XI. bis zu Leo XIII. werden sowohl unter behörden- als auch sozialgeschichtlichen Gesichtspunkten untersucht. Die Auswertung von umfangreichem Archivmaterial aus dem Vatikanischen Geheimarchiv und von Quellen aus Archiven in Rom, Neapel, Mailand, Venedig und Wien und zahlreichen kleineren italienischen Kommunen erlaubt einen ungewöhnlichen Einblick in die Beziehungen des Papsttums zu den italienischen Staaten und in die Sozialgeschichte der italienischen Kirche. Das Oszillieren zwischen Personalpolitik und Personalbürokratie, zwischen Machtinteressen und Kriterienanforderungen wird über mehr als zwei Jahrhunderte verfolgt. Die unterschiedlichen Sozialformen der katholischen Kirche in Nord- und Süditalien werden in ihrem jeweils eigenen zeitlichen Beharrungsvermögen sichtbar gemacht. Während die Sozialgeschichte Norditaliens in der Neuzeit im deutschen Sprachraum besser bekannt ist, sind deutsche Arbeiten über die Gestalt Süditaliens in der Neuzeit erheblich seltener. Der in dieser Studie angestellte Vergleich relativiert unser vornehmlich an west- und nordeuropäischen Gegebenheiten orientiertes Bild der sozialgeschichtlichen Entwicklung der Führungseliten in der frühen und späteren Neuzeit.
Bitte wählen Sie Ihr Anliegen aus.
Rechnungen
Retourenschein anfordern
Bestellstatus
Storno