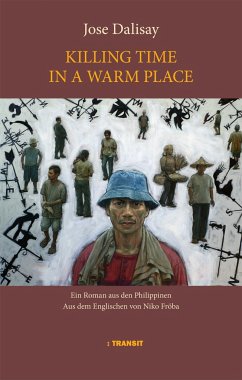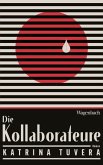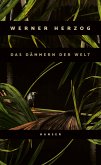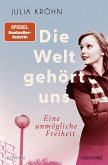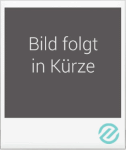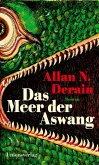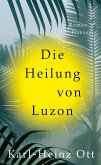Der Roman »Killing Time in a Warm Place« erzählt von einer Kindheit und Jugend in der Marcos-Zeit, von Menschen und Familien, die auf dem Land oder in Städten wohnen, immer auf dem Sprung nach einer besseren Arbeit, einem besseren Leben für sich und ihre Kinder. Die meisten arrangieren sich mit der Diktatur, mit der allgegenwärtigen Polizeigewalt und der Korruption; sie folgen dem Marcos-Regime auch noch dann, als das Kriegsrecht ausgerufen wird. Es gibt aber auch politischen Widerstand, ausgehend von Studentinnen und Studenten, die sich teils der maoistischen Bewegung anschließen, teils eigene riskante Wege gehen, um die Diktatur zu bekämpfen. Dalisay beschreibt diese Situation aus den Augen junger Menschen, die auf der Suche nach Idealen sind, ihre Karriere opfern, von Militär und Geheimpolizei beobachtet, verhaftet und auch gefoltert werden, dann lange Jahre in Lagern verbringen müssen, bis das Regime unter Massenprotesten endlich zusammenbricht. Der Roman entfaltet ein gewaltiges und buntes Panorama über das Leben auf den Philippinen, über das Abstumpfen in einer Diktatur, über politisches Wachwerden und auch über Irrungen und Wirrungen des studentischen Widerstands. Und das alles in einer lebendigen, facettenreichen Sprache, gewürzt mit viel Ironie und Witz.
Westdeutscher Rundfunk WestArt, Holger Heimann Wie die Dinge laufen auf den Philippinen, das ist im Roman von Jose Dalisay offensichtlich. Unter dem Diktator Ferdinand Marcos blühen in den 1960er Jahren Vetternwirtschaft und Korruption. Als Studenten gegen das Regime aufbegehren, verhängt Marcos 1972 das Kriegsrecht und lässt die Aufrührer verfolgen. Es ist »Killing Time«. Jose Dalisay war auf der Seite der Aufständischen, der Opposition. Es sind seine Erfahrungen und die seiner Freunde, die in den Roman einfließen. Dalisay blickt nicht ohne Selbstironie und Sarkasmus auf die Träume seiner Generation zurück. Jose Dalisay zeichnet mit wenigen kraftvollen Strichen ein so eindrucksvolles wie entlarvendes Porträt einer zynischen Gesellschaft, die von tradierten Hierarchien und Abhängigkeiten bestimmt wird. Wer das Buch liest, wird weniger überrascht davon sein, dass heute der Sohn von Ferdinand Marcos Präsident des Landes ist. "Killing Time in a Warm Place" macht überzeugend deutlich, dass der Aufstand einer Gruppe junger Idealisten nicht genügte, um festgefügte Strukturen und machtvolle Traditionen aufzulösen. Die Geschicke des Landes werden gegenwärtig - wie vor 50 Jahren - von Familiendynastien bestimmt.