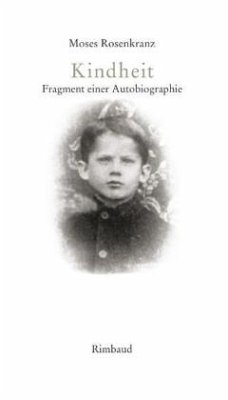Die ersten fünfzehn Jahre dieses Lebens, das noch viele Katastrophen unseres Jahrhunderts durchlaufen sollte, schildert der Dichter im vorliegenden Buch.Weiteres zum Lebenslauf im Essay von Matthias Huff.Der Autor, geboren am 20. Juni 1904 in Berhometh am Pruth, lebte bis 1930 vorwiegend in der Bukowina, dann in Bukarest. 1941 bis 1944 war er in Arbeitslagern der rumänischen Faschisten interniert; 1947, verschleppt nach Rußland, verschwand er für 10 Jahre im Gulag. 1961, wieder politisch verfolgt, mußte er aus Rumänien fliehen und kam nach Deutschland. Er starb am 17. Mai 2003 im Schwarzwald.Die Kindheit erlebte er bis zum 1. Weltkrieg in den Dörfern zwischen Pruth und Czeremosch in einer kinderreichen Bauernfamilie. Dann folgten Flucht, der Tod des Vaters, völlige Verarmung; danach Wanderjahre auf Arbeitssuche.

Fern der Bukowina: Die Autobiographie von Moses Rosenkranz
Moses Rosenkranz verfügt über eine seltene Gabe: Er hat das Gehör für die Sprache. Daß auch Melodie und Rhythmus zum Satz gehören, daß er mehr ausdrücken kann als die zusammengenommene Bedeutung der Worte, sei ihm früh aufgefallen, berichtet der Schriftsteller in seiner Autobiographie. Noch bevor er ihre Inhalte erfassen konnte, habe ihn der Klang der Wörter angezogen. Wie "einen Trinker" der Alkohol, so hätten ihn die Töne berauscht, als er mit Brentanos "Märchen von Gockel, Hinkel und Gackeleia" erstmals in den "dunklen Zauberwald der Sprache" geraten sei. "Ich begriff nicht den Sinn", schreibt er rückschauend, "nicht den Inhalt, die Fabel, den Aufbau, den Stil, die Syntax des Märchens, aber ich habe es mit dem Herzen und durch das Blut in allen meinen Fibern aufgenommen." Dabei konnte das Kind um so spontaner reagieren, als das Deutsche nicht eigentlich seine Muttersprache war, jedenfalls nicht mehr als das Jiddische, mit dem sich die Familie ebenso durchschlagen mußte wie mit polnischen Brocken oder mit dem Ruthenischen, dem Idiom der Ukrainer.
Allein durch die melancholische Färbung ihrer Vokale hatte sich die eine Stimme aus dem Gewirr der Sprachen herausgehoben; wie ein Instrument wollte sie der Autor beherrschen. Wie von selbst ergab sich die ästhetische Beziehung. Zur Lebensnotwendigkeit wurde der Gebrauch des Deutschen erst sehr viel später, 1961, als Moses Rosenkranz im Alter von siebenundfünfzig Jahren in die Bundesrepublik übersiedelte. Bis dahin war ihm die einzig "geliebte" Sprache nichts als ein gepflegtes, ein Kunstmittel gewesen, eines, das es erlaubte, dem Affekt zu entkommen, literarisch aufzuheben, was alltäglich geschah, weitab in den Grenzgebieten erschöpfter Imperien, in den kleinen Dörfern der Bukowina, dort, wo die Weltmächte in der Provinz aufeinandertrafen.
Ein Ort der Unruhe war das Land der Buchen, wo er 1904 geboren wurde, für den Ostjuden von Anfang an. Zwar hatte es der Vater verstanden, sich mit einigem Erfolg als Landwirt einzurichten; die ersehnte Bodenständigkeit jedoch konnte er niemals erlangen. Als Pächter blieb er abhängig von den Grundherren. Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges wurde er endgültig zurückgeworfen auf den Handel. Nur mit dem, was man den Juden von jeher zugestanden hatte, war die Familie jetzt noch durchzubringen. Wie ein Abschied von den besseren Zeiten mußte dem Nachkommen der fortschreitende Zerfall Österreich-Ungarns erscheinen, da er einherging mit dem Beginn einer umgetriebenen Existenz, mit andauerndem Orts- und Wohnungswechsel.
Zum persönlichen Erlebnis wurde die politische Auflösung, der Verlust einer Sicherheit, wie sie der Vater im Vielvölkerstaat erlebt haben wollte. Als "ein Völkerinternat mit Habsburg als Schaltmeister" hatte der Assimilierte das Ganze angesehen; deutlich abgesetzt war es in seinen Augen von dem angrenzenden "Völkergefängnis", für das er die russische Großmacht hielt. Wie in "einer Traumschau", entsann Moses Rosenkranz sich Jahrzehnte darauf, habe er schon ehedem, in den Erzählungen der Alten, "die beiden Schicksalsreiche" seines Lebens erblicken können: das untergehende und das drohende vor allem, jenes also, das ihn 1947, nach Jahren rumänischer Internierung, unter dem Verdacht der Deutschfreundlichkeit entführen und in den GULag ans nördlichste Ende Sibiriens schicken sollte. Daß die Erinnerungen, mit deren Niederschrift er danach, 1958 in Bukarest, begann, bei aller Einsicht in die historische Zwangsläufigkeit nicht umhinkommen, die Zerstörung der überlebten Donaumonarchie als Verlust zu empfinden, ist eine Folge geschichtlicher Erfahrung - ebenso wie der nüchterne Blick auf die "Revolutionsgärtner", die bereits damals im Begriff waren, "ihre Galgenbäumchen für die Zukunft" zu säen.
Moses Rosenkranz weiß, was verlorenging. Wenn er sich erinnert, tut er es stets mit dem Wissen um das Nachkommende, ohne alle Sentimentalität, aber nicht ohne Melancholie. Seine Geschichten sind die eines Vertriebenen. Von keiner Utopie läßt er sich etwas vormachen; keine Ideologie kann ihn über die Realität hinwegtäuschen. Zu vieles hat er sehen müssen, zu oft mußte er ausweichen, vor den Russen, vor den Deutschen und vor den Rumänen, vom Dorf in die Stadt, nach Czernowitz, und dann wieder zurück aufs Land, von einem Ort zum anderen. Wie nach Prag, so hat es ihn nach Paris und nach Bukarest verschlagen, am Ende nach Deutschland, in den Hochschwarzwald, wo er noch heute lebt, zurückgezogen von einer Öffentlichkeit, die ihn seit vierzig Jahren enttäuscht, weil sie nichts mehr anzufangen weiß mit einem, der von sich sagt: "Ich trug mein Dorf in mir, und das war gewichtig genug."
Nein, das Übliche, die Rolle des intellektuellen Selbstdarstellers ist seine Sache nie gewesen. Am liebsten wäre er ohnehin Bauer geworden, einer freilich, der zugleich auch in der Dichtung leben wollte. War doch schon dem Knaben das Herz aufgegangen, wenn er sich Ludwig Uhlands Verse laut vorlas. "Ich erlebte das Glück lückenlosen Verständnisses in der Sprache", schreibt er in seiner jetzt erstmals veröffentlichten Autobiographie. Und wer sich darauf erst einmal einläßt, der ist dann schnell eingesponnen von der Handlung eines Bildungs- und Erziehungsromans, wie ihn die Romantiker poetischer kaum hätten erfinden können.
Immer bleiben die Aufbrüche, zu denen es den Helden treibt, überschattet von der Sehnsucht nach seiner "ersten Landschaft mit der Wolke über dem Baum mit Wiese und Fluß". Noch in der Enttäuschung des Daseins wird das harmonische Verlangen aufgehoben durch den dunklen Wohlklang der Wörter. Schmerz und Glück, alles machen sie in einem spürbar, wenn Moses Rosenkranz von seiner Kindheit erzählt, von der bedrängten Existenz der Eltern, von der Freiheit und der Not des Landlebens, vom Krieg, von erster Liebe, von homoerotischer Neigung oder sexuellem Erwachen und von der Entdeckung der Sprache immer wieder. Von ihrer Kraft handeln die Erinnerungen durchweg. Was sie dem Autor bedeutet, verrät die Melodie der Sätze. Gern würde man ihnen noch länger zuhören. Vorerst aber endet die Geschichte nach 200 Seiten im Jahr 1920. Wie es weiterging, wie Moses Rosenkranz zum Schriftsteller wurde, wie er sich das Gehör für die Sprache bewahrte, soll ein bislang unveröffentlichter zweiter Teil erzählen.
THOMAS RIETZSCHEL
Moses Rosenkranz: "Kindheit". Fragment einer Autobiographie. Herausgegeben von George Gutu. Rimbaud Verlagsgesellschaft, Aachen 2001. 252 S., geb., 25,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Jörg Drews zeigt sich überaus beeindruckt von diesen Erinnerungen des 1904 in der Bukowina geborenen Autors, der in bitterster Armut aufwuchs, sich als Kind jedoch schon von der deutschen Sprache faszinieren ließ und nach Jahren der Lagerhaft, Verfolgung und Unterdrückung 1961 nach Deutschland floh. Die Liebe zum Deutschen findet Drews angesichts von Rosenkranz' Lebensgeschichte erstaunlich, und das Deutsch, das Rosenkranz verwendet, ist seiner Beobachtung nach ein "intensives, hochpoetisches, präzises, wie hastiges und zugleich unverbildetes Deutsch". Drews bedauert es sehr, dass der Autor seine Autobiografie nicht vervollständigen wollte, doch hofft er, dass das noch erhaltene Fragment 'Jugend' bald ebenfalls veröffentlicht werden wird. Im vorliegenden Band nämlich sieht der Rezensent ein unbedingt lesenswertes "dichterisch bedeutendes und als Zeitzeugnis unvergleichliches autobiografisches Fragment".
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH