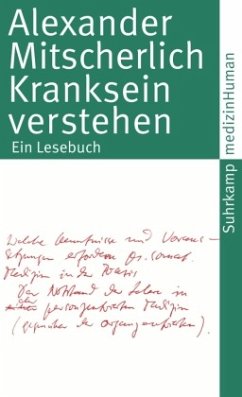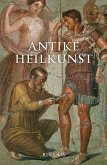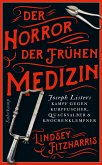Die Medizinverbrechen der Nazis waren nicht das Ergebnis der Verfehlungen Einzelner, sondern der extreme Endpunkt des Glaubens an ärztliche und naturwissenschaftliche Objektivität - mit dieser kontroversen These handelte sich Alexander Mitscherlich nicht nur Widerspruch des medizinischen Mainstreams seiner Zeit ein, sondern legte auch den Grundstein einer verstehenden, menschlichen Medizin, die Krankheit als Ergebnis nicht nur organischer, sondern auch lebensgeschichtlicher und sozialer Ursachen begreift. Denn ein kranker Mensch ist mehr als ein defekter Organismus. Der vorliegende Band versammelt und ordnet seine zentralen Texte zur Menschlichkeit in der Medizin.
Dieses Buch ist Teil der Reihe medizinHuman.
Die Buchreihe bietet eine Plattform für Bücher, die spannend und verständlich aktuelle Entwicklungen des Gesundheitswesens und der medizinischen Praxis hinterfragen und für eine Heilkunst plädieren, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt: für eine Humanmedizin, die diesen Namen verdient.
Dieses Buch ist Teil der Reihe medizinHuman.
Die Buchreihe bietet eine Plattform für Bücher, die spannend und verständlich aktuelle Entwicklungen des Gesundheitswesens und der medizinischen Praxis hinterfragen und für eine Heilkunst plädieren, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt: für eine Humanmedizin, die diesen Namen verdient.