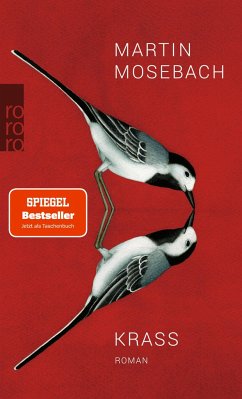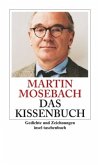Eine abgründige Geschichte über Liebe, Macht und Abhängigkeit.
Ralph Krass - so heißt ein verschwenderisch großzügiger Geschäftsmann, der Menschen mit kannibalischem Appetit verbraucht. Ist er unendlich reich oder nur ein Hochstapler, kalt berechnend, oder träumt er hemmungslos? Ein Mann, der niemals Zeit hat und in anderen Menschen nur Marionetten sieht. Als in Neapel Lidewine in seinen Kreis tritt - eben noch die Assistentin eines Zauberers, eine junge Abenteurerin - und sie sich ihm widersetzt, verfällt er darauf, ihr einen ungewöhnlichen Pakt anzubieten. «Krass» ist ein atmosphärischer, bildstarker Roman über das, was das Verstreichen von Zeit mit Menschen tut, über Liebe, Verlust und magisches Wiederfinden.
Ralph Krass - so heißt ein verschwenderisch großzügiger Geschäftsmann, der Menschen mit kannibalischem Appetit verbraucht. Ist er unendlich reich oder nur ein Hochstapler, kalt berechnend, oder träumt er hemmungslos? Ein Mann, der niemals Zeit hat und in anderen Menschen nur Marionetten sieht. Als in Neapel Lidewine in seinen Kreis tritt - eben noch die Assistentin eines Zauberers, eine junge Abenteurerin - und sie sich ihm widersetzt, verfällt er darauf, ihr einen ungewöhnlichen Pakt anzubieten. «Krass» ist ein atmosphärischer, bildstarker Roman über das, was das Verstreichen von Zeit mit Menschen tut, über Liebe, Verlust und magisches Wiederfinden.
Mosebach ist hier ein Werk gelungen, dem man ohne falsche Feierlichkeit das Schicksal eines unverwüstlichen Klassikers prognostizieren darf. (...) eine raffiniert durchkomponierte Meistererzählung über das Glück des Untergangs. Marianna Lieder Die Welt 20210206
Spannend und durchtrieben findet Rezensent Jens Jessen Martin Mosebachs Roman. Wie der Autor mit seiner Geschichte um einen obskuren Waffenhändler beim Leser eine Erwartungshaltung erzeugt, die einem Thriller gebührt, ohne dabei wirklich grundstürzend Verdächtiges oder Monströses aufzutischen, findet Jessen phänomenal. Der Wunsch nach Aufklärung wächst im Rezensenten von Seite zu Seite, bis er erkennt, dass das Ungeheuerliche vor allem in seinem Kopf entsteht, während der Autor "nur" geschickt mit der Erzählperspektive und der Konstruktion seines Textes spielt.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH