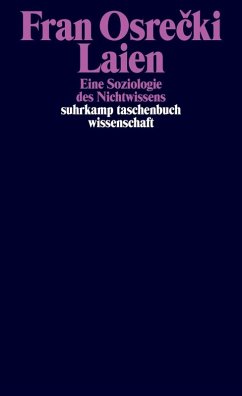Die moderne Gesellschaft lädt Laien in vielen Bereichen zum Mitmachen ein. Als Wähler, Konsumentin, Mediennutzer, Patientin oder Studierender darf und soll man Expertinnen und Experten mit Wünschen, Sorgen oder Beschwerden konfrontieren. Aber um mit diesen auf Augenhöhe zu kommunizieren, scheinen sich Laien auch engagieren und informieren, ja selbst ein stückweit zu Experten werden zu müssen. Fran Osrecki stellt solche Annahmen in seinem Buch auf den Kopf: Laien sind in der modernen Gesellschaft dann stark, wenn sie uninformiert, sprunghaft, inkonsistent und unberechenbar agieren. Das Nichtwissen ist ihre wichtigste Ressource. Laien bilden ein unbekanntes Publikum und spielen gerade als solches eine wichtige Rolle in unserer funktional differenzierten Gegenwartsgesellschaft.
Bitte wählen Sie Ihr Anliegen aus.
Rechnungen
Retourenschein anfordern
Bestellstatus
Storno