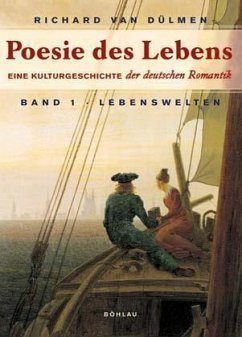Auf der Grundlage der Lebenszeugnisse von u. a. Schlegel, Tieck, Novalis, Brentano, Hoffmann, Eichendorff, Friedrich, Runge, Carus und von Weber beschreibt Richard van Dülmen die Lebenswelt der Romantiker, deren Mythos bis heute nachwirkt, im soziokulturellen Kontext der Zeit um 1800.
Die deutsche Romantik zählt mit ihrer unglaublichen Phantasie, ihrer mächtigen Ausdrucksgewalt und philosophischen Breite zu den bemerkenswertesten Kulturen der Neuzeit. Unendlich vielschichtig ließ sie keinen Bereich aus: Natur und Kunst, Wissenschaft und Geschichte, Musik und Politik, Gefühl und das Unbewusste. Diese Kulturgeschichte zeigt die Romantik in ihrer ganzen Vielfalt, schöpferischen Breite und sozialen Dimension: Herkunft und Ausbildung, weibliche Lebenswelten, Lebensplanungen und Schriftstellerleben, Freundschaftsbünde, Briefwechsel und Selbstbekenntnisse, die Bedeutung der Französischen Revolution, Liebe, Ehe und Scheidung, Glaube, Religion und Konversionen werden beschrieben. Hochbegabte Männer und Frauen erträumten und erdichteten sich ein neues Leben, indem sie es zu einem Kunstwerk zu gestalten suchten. Selbstverwirklichung durch Dichtung und Wissenschaft stand nun im Vordergrund, künstlerisch und emotional ging man neue Wege. Gemessen an ihren Wünschen und S ehnsüchten sind die Romantiker gescheitert. Doch wurde das neue Liebes- und Geselligkeitsideal zur Lebensmaxime einer ganzen Generation.
Die deutsche Romantik zählt mit ihrer unglaublichen Phantasie, ihrer mächtigen Ausdrucksgewalt und philosophischen Breite zu den bemerkenswertesten Kulturen der Neuzeit. Unendlich vielschichtig ließ sie keinen Bereich aus: Natur und Kunst, Wissenschaft und Geschichte, Musik und Politik, Gefühl und das Unbewusste. Diese Kulturgeschichte zeigt die Romantik in ihrer ganzen Vielfalt, schöpferischen Breite und sozialen Dimension: Herkunft und Ausbildung, weibliche Lebenswelten, Lebensplanungen und Schriftstellerleben, Freundschaftsbünde, Briefwechsel und Selbstbekenntnisse, die Bedeutung der Französischen Revolution, Liebe, Ehe und Scheidung, Glaube, Religion und Konversionen werden beschrieben. Hochbegabte Männer und Frauen erträumten und erdichteten sich ein neues Leben, indem sie es zu einem Kunstwerk zu gestalten suchten. Selbstverwirklichung durch Dichtung und Wissenschaft stand nun im Vordergrund, künstlerisch und emotional ging man neue Wege. Gemessen an ihren Wünschen und S ehnsüchten sind die Romantiker gescheitert. Doch wurde das neue Liebes- und Geselligkeitsideal zur Lebensmaxime einer ganzen Generation.