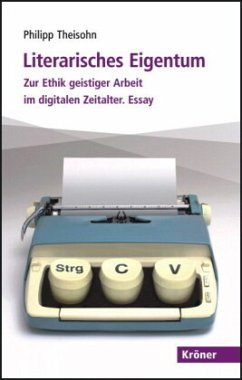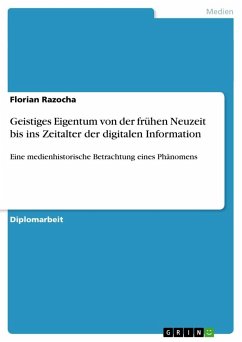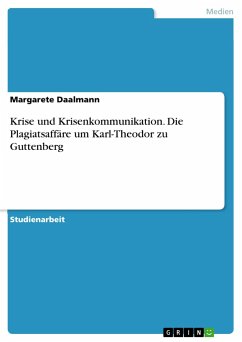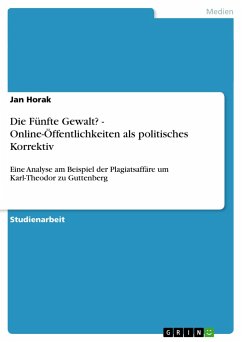Die medientechnologische Entwicklung der letzten Jahrzehnte hat auch das wissenschaftliche und literarische Arbeiten revolutioniert. Öffentliche Plagiatsdebatten um 'die Fälle' zu Guttenberg oder Helene Hegemann, aber auch der an den Universitäten schwelende Kampf um Open Access haben die Frage, ob das 21. Jahrhundert ein neues Urheberrechtsdenken braucht, ins Zentrum der gesellschaftlichen Aufmerksamkeit gerückt.In gewohnter Prägnanz und Scharfzüngigkeit begleitet der Spezialist auf dem Gebiet des Plagiats die aktuellen Diskussionen mit seinen eigenen Überlegungen und legt ihre Hintergründe offen. Sein Plädoyer für eine neue Textethik im digitalen Zeitalter versteht sich als konstruktiver Beitrag zur öffentlichen und politischen Diskussion.
Bitte wählen Sie Ihr Anliegen aus.
Rechnungen
Retourenschein anfordern
Bestellstatus
Storno