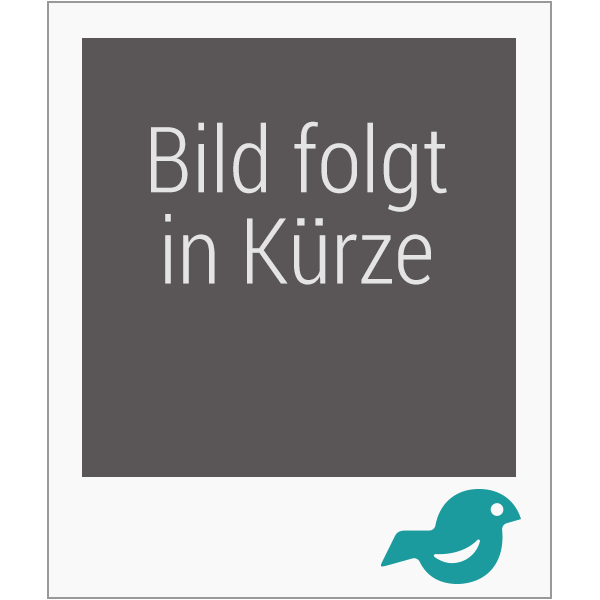Lothar Kreyssig (1898 - 1986) würde am 30. Oktober 1998 seinen 100. Geburtstag feiern. In dieser Biographie wird Kreyssigs Leben vom Widerstand gegen das Euthanasieprogramm der Nazis bis zur Gründung der Aktion Sühnezeichen geschildert. Konrad Weiß stützt sich dabei auf bisher unzugängliche Dokumente aus dem Nachlaß sowie Interviews mit Zeitzeugen und Weggefährten.

Chronik eines Lebens zwischen Glauben und Politik
Konrad Weiß: Lothar Kreyssig. Prophet der Versöhnung. Bleicher Verlag, Gerlingen 1998. 464 Seiten, 10 Abbildungen, 54,- Mark.
Der Aufruf zur Gründung der "Aktion Sühnezeichnen" im Jahre 1958 erging zu einer Zeit, in der die Zeichen nicht auf Versöhnung standen. Auf einer in Berlin tagenden Synode der damals noch gesamtdeutschen Evangelischen Kirche Deutschlands verlas Lothar Kreyssig, Präses der sächsischen Provinzialsynode, einen schlichten Text, der mit den Worten "Wir bitten um Frieden" begann. Er bat die von den deutschen Gewaltverbrechen im Zweiten Weltkrieg betroffenen Völker darum, in deren Ländern als Zeichen der Sühne gemeinnützige Einrichtungen aufbauen zu dürfen, um auf diese Weise der Versöhnung als Grundlage des Friedens näher zu kommen.
Die Initiative, die von Kreyssigs aufrichtiger Sühnebereitschaft inspiriert war, fand zwar Resonanz in West und Ost, blieb aber ebensowenig wie die Kirche selbst vom Prozeß der Spaltung verschont. Drei Jahre später, als der Mauerbau alle organisatorischen Zusammenhänge abbrach, waren von Westdeutschland aus vier Sühnezeichen-Gruppen in Holland, Frankreich, Griechenland und England tätig, während die ostdeutschen Anhänger der Aktion sich zunächst in Sommerlagern sammelten und einige im Krieg zerstörte Kirchen wieder aufbauten. Das SED-Regime verbot selbst Fahrten in die osteuropäischen "Bruderländer", denn die Bürger der sozialistischen DDR, so die offizielle Begründung, hätten mit dem nationalsozialistischen Unheil nichts zu tun und deshalb auch niemanden um Vergebung zu bitten. Viele der meist jugendlichen Mitglieder der informellen Sühnezeichen-Gruppen wuchsen später in die oppositionelle Bürgerrechtsbewegung hinein, die 1989 zum Sturz des Regimes aufrief.
Zu ihnen gehörte auch der damalige Dokumentarfilmregisseur und spätere Bundestagsabgeordnete Konrad Weiß. Er lernte Kreyssig 1964 bei einer Fahrt nach Auschwitz kennen, die durch eine Überlistung der DDR-Behörden zustande gekommen war. "Das Schweigen des wortgewaltigen Mannes an diesem Ort", schreibt Weiß im Vorwort seiner Biographie Lothar Kreyssigs, "hat uns Junge damals im Innersten erschüttert und uns besser verstehen lassen, wo wir sind". Zwölf Jahre nach Kreyssigs Tod legt Weiß ein Porträt vor, das er aus dem autobiographischen Nachlaß sowie aus Gesprächen mit den Söhnen und verschiedenen Zeitgenossen, darunter Helmut Gollwitzer und Kurt Scharf, zusammengetragen hat. Da Kreyssig fast vier Jahrzehnte lang die Geschicke der evangelischen Kirche in Ost und West dynamisch mitgestaltet hat, geriet die Biographie zur Chronik unzähliger Synoden, Konferenzen und Kongressen. Dies führt streckenweise zu einer durch die optische Unübersichtlichkeit des Buchs noch verstärkten Überversorgung mit berichterstattendem Material, das gleichwohl interessante Funde enthält. Dazu zählt vor allem die von der internen Detailkenntnis des Autors zeugende Geschichtsschreibung der "Aktion Sühnezeichnen" vor dem Hintergrund des Ost-West-Konflikts, aber auch die Dokumentation der Anfänge der "Bekennenden Kirche", die sich 1934 in Abgrenzung von den nationalsozialitisch unterwanderten "Deutschen Christen" konstituiert hatte.
Der 1898 im sächsischen Flöha geborene Landgerichtsrat Kreyssig geriet als bekennender Christ schon bald in Widerspruch mit der nationalsozialistischen Rechtsauffassung. Der Konflikt entzündete sich am sogenannten Euthanasie-Programm, der organisierten Tötung von Hunderttausenden kranker und behinderter Patienten aus Heil- und Pflegeanstalten. Kreyssig war einer der wenigen deutschen Richter, der die stillschweigend geduldete Verkehrung von Recht und Verbrechen nicht mitmachte, sondern stattdessen den verantwortlichen Reichsleiter wegen Mordes anzeigte. Dies sowie andere Aktenvermerke seiner widerständig-sperrigen Haltung brachten ihm 1942 die Zwangspensionierung ein. Fortan widmete er sich ganz dem Dienst in der Bekennenden Kirche sowie der biologisch-dynamischen Landwirtschaft auf seinem Bauernhof im Brandenburgischen. Hier versuchte er, die Utopie einer vom christlichen Glauben getragenen Hofgemeinschaft zu verwirklichen, in der Familienmitglieder, Angestellte und später auch häufig Versteckte und Verfolgte Schutz finden sollten.
So manches am männerbündischen Gestus, am patriarchalen Stil des religiösen Eiferers Kreyssig ist nicht nur dem Biographen befremdlich, der zuweilen um die Balance zwischen persönlicher Loyalität und kritischer Perspektive ringt. Man ist dankbar für jeden Ansatz zur Distanz, aus der heraus sich erst die Bedeutung jenes "theologischen Freibeuters" klar abzeichnet. Sie liegt, neben seiner mutigen Haltung gegenüber totalitärer Staatsgewalt, in der risikofreudigen und temperamentvollen Unbeirrtheit, mit der Kreyssig einen bürokratisch verfaßten Kirchenapparat in Bewegung zu bringen verstand. Denn nicht nur gegenüber dem Staat, sondern auch innerkirchlich steuerte er stets unbequemeren Kurs. So kritisierte er den auch in der Bekennenden Kirche latent vorhandenen Antisemitismus und vertrat schon früh den Ökumene-Gedanken gegen den Vorwurf der "romanisierenden" Tendenz. An der Einheit der Kirche hielt er noch fest, als der deutsch-deutsche Bruch längst stillschweigend besiegelt war. "Der Christ muß widerstehen, weil Gott es befiehlt", das sah er als seine persönliche Berufung an. Vor den Konsequenzen scheute er sich nicht.
SABINE FRÖHLICH
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main