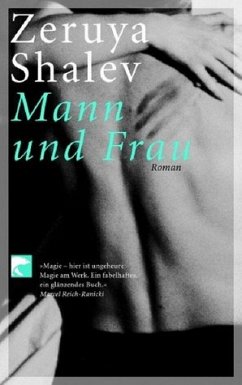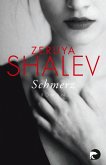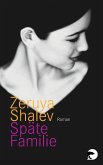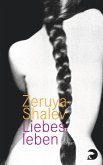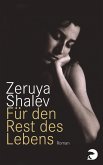Produktdetails
- Verlag: Berliner Taschenbuchverlag
- ISBN-13: 9783442760947
- ISBN-10: 3442760941
- Artikelnr.: 21351901
- Herstellerkennzeichnung Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.

Zeruya Shalev: "Mann und Frau" / Von Kristina Maidt-Zinke
Diesmal braucht der israelische Literaturkritiker Mordechai Shalev nicht gar so schamhaft über gewisse Stellen hinwegzublättern: Seine als Schriftstellerin erfolgreiche Tochter Zeruya geht in ihrem neuen Roman mit erotischen Details ungleich sparsamer und dezenter um als in ihrem vieldiskutierten Bestseller "Liebesleben". Erzählte sie dort von einer nicht immer appetitlichen sexuellen Obsession mit pikantem Altersunterschied und inzestuösem Beigeschmack, so hat sie sich nun dem Ernst des reiferen Ehe- und Familienlebens zugewandt, das "Mann und Frau" zwar noch die eine oder andere Kopulationsszene beschert, dessen Problemzonen sich jedoch mehrheitlich oberhalb der Gürtellinie befinden. Die Ich-Heldin Na'ama kommt so atemlos redselig und pathetisch reflexionsbesessen daher wie ihre Vorgängerin Ja'ara, hat aber jener jungen Bibelwissenschaftlerin nicht nur einiges an Jahren voraus, sondern verfügt auch über einen soliden Kontakt zur Realität, da sie in einem Heim für ledige Mütter arbeitet und selbst Mutter einer frühpubertierenden Tochter ist. Udi, der dazugehörige Gatte und Vater, ist Reiseleiter von Beruf und entschieden weniger farblos als weiland Ja'aras stupsnasiger, libidogestörter Gemahl. Daß wir es erneut mit einem Fall von weiblicher Frustration und Selbstbefreiung zu tun haben, kündigt sich indes schon auf der ersten Seite an: Udi riecht morgens aus dem Mund "wie ein alter Schuh", und kaum wacht er auf, macht er gehässige Bemerkungen. Diese Ehe hat ihre besten Zeiten hinter sich.
Hier ist es allerdings der Mann, der die Ketten der schal gewordenen Zweisamkeit sprengt, nachdem ihn sein Körper mit dramatischen Warnzeichen darauf aufmerksam gemacht hat, daß er unter seelischem Druck steht. Als erstes und bedrohlichstes Symptom dieser sogenannten "Konversionsneurose", nicht zu verwechseln mit Konversationsneurose, tritt bei Udi eine hypochondrische Ganzkörperlähmung auf, die in der nicht weniger neurosengeschüttelten Na'ama zunächst die Hoffnung weckt, sie könne den rastlosen Wandervogel endlich ans Haus fesseln: ". . . ein verwöhnter Gefangener wird er sein, ein Riesenbaby, das sich noch nicht auf den Bauch drehen und krabbeln kann, so behalten wir ihn für uns, er soll weder gesund werden noch sterben, das Baby, das ich mir gewünscht habe, das Baby, das uns zu einer Familie machen wird".
Würde die Erzählerin es uns nicht wortreich erläutern, könnten wir es ohne Mühe erraten: Na'ama möchte ihren Mann ganz für sich, obwohl ihre Leidenschaft längst abgekühlt ist; sie fühlt sich von ihm bedrängt und eingeengt und ist zugleich von ihm abhängig; sie hat ihr ganzes Dasein auf seine Wünsche und Bedürfnisse abgestimmt und wird trotzdem, wie es eben Art der Frauen ist, von Schuldgefühlen geplagt. Die stabilste Harmonie haben die beiden erlebt, als ihre Tochter ein Baby war, das ihrer beider Zuneigung bündelte und verstärkte. Doch als die kleine Noga eines Tages den sonst so fürsorglichen Händen des Vaters entglitt, vom Balkon fiel und in Lebensgefahr schwebte, zerbrach das Idyll, und Argwohn vergiftete fortan die Dreierbeziehung. Als Strafe Gottes deutete Na'ama den Vorfall, hatte sie sich doch kurz vorher in einen Maler verliebt und nur deshalb der fleischlichen Versuchung widerstanden, weil Udi durch Zufall hinter ihr Geheimnis gekommen war. Natürlich traut er ihr seitdem nicht mehr über den Weg. Ja, und dann ist da noch das Familiendrama, das Na'ama mit sich herumschleppt: Ihre Mutter verließ seinerzeit kaltblütig Heim, Herd und Kinder, um ihrer künstlerischen Berufung zu folgen. Kein Wunder, daß sich die Heldin nach ihrer Entbindung an Mann und Säugling klammern mußte, "als wären sie mein Vater und meine Mutter, die wieder zusammenleben wollten, weil ich ein braves Mädchen gewesen war".
Das ist Psychologenfutter, des Frauentherapeuten täglich Brot, doch als Literatur nur unter Vorbehalt genießbar. Zeruya Shalev legt noch eins drauf, indem sie in den zerrütteten Jerusalemer Haushalt eine tibetanische Heilerin einführt, die Räucherstäbchen entzündet, Buddhas Lehren predigt und den konversionskranken Udi im Handumdrehen wieder auf die Beine bringt, so nachhaltig, daß er wenig später mit dem leicht abgewandelten Rilke-Wort "Ich muß mein Leben ändern" seinen Auszug avisiert. Für Na'ama bricht die Welt zusammen, denn eine Frau ohne Mann ist für sie "eine Frau ohne Daseinsberechtigung", und daß der wundersam Genesene zielstrebig in die Arme jener schlanken Asiatin flieht, macht die Sache nicht besser. Dann aber zeigt sich, daß der Kontakt mit fernöstlicher Weisheit auch an der Verlassenen nicht spurlos vorübergegangen ist: Nachdem sie sich mit ihrer Mutter ausgesprochen, im Mädchenheim ihre sozialarbeiterischen Qualitäten bewiesen und mit einem leichtfüßigen Architekten im Schlafzimmer einer Musterwohnung die frivole Seite ihres Wesens ausgelebt hat, kann sie sich von alten Denkmustern lösen, lernt ihre Freiheit schätzen und widmet sich ihrer Tochter liebevoller als bisher.
Zeruya Shalev hat offenbar beherzigt, was einige Kritiker sich nach ihrem letzten Buch von ihr wünschen: weniger kruden Sex, mehr Israel. Eine Versöhnungsreise, die Udi und Na'ama in die Wüste von Jericho führt, zeitigt zwar nicht die erhoffte Wirkung, gibt der Autorin aber Gelegenheit, ihr Psychodrama von internationalem Zuschnitt mit einheimischen Landschaftsbildern zu dekorieren, und das alttestamentarische Donnerwort, das schon im "Liebesleben" zum Zuge kam, weiß die Bibelkundlerin Shalev auch hier wieder sinnstiftend einzusetzen. Ihr emotionsgeladener Erzählstrom, in seinen stärksten Momenten mitreißend trotz hohen Kitschrisikos, gebiert in schwächeren Augenblicken mißglückte Metaphern von eigenwilligem Reiz: Da fliegen Brotscheiben aus dem Toaster "wie heiße Ohrfeigen", eine Glatze "gleitet grau wie ein Wasserfall bei Nacht an mir vorbei", beim Geschlechtsakt öffnen sich "die Schranken für die verzuckerten Waggons der Lust", der Sommer sitzt "mit glühenden Arschbacken auf seinem Thron", und hin und wieder klopft ein neues Baby "an die knarrenden Türen unsere Herzen". Das Motto über der Geschichte jedenfalls könnte lauten: Alles wird gut. Und wenn dies schon kein Buch für "Mann und Frau" ist, so ist es doch, horribile dictu, ein waschechter Frauenroman.
Zeruya Shalev: "Mann und Frau". Roman. Aus dem Hebräischen übersetzt von Mirjam Pressler. Berlin Verlag, Berlin 2001. 399 S., geb., 39,80 DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main