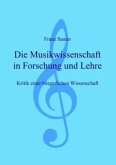Max Webers Fragment gebliebene, postum veröffentlichte Musik-Studie ist ein kaum beachtetes Kleinod im Gesamtwerk des Heidelberger Juristen, Nationalökonomen und Sozialwissenschaftlers. Ihre Fachfremdheit und ihre einzigartige Materialdichte verhinderten bislang eine angemessene Rezeption. Weber selbst nahm hingegen an zentralen Stellen seines Werkes Bezug auf die sogenannte 'Musiksoziologie'. In ihr legt er die Besonderheit der okzidentalen und modernen europäischen Kultur im Bereich der Musik dar und erörtert ihre historischen Entstehungsbedingungen in universalhistorischer Perspektive. Er diskutiert Idealtypen und Richtungen musikalischer Rationalisierungen und deren instrumentelle Ausgestaltungen, wobei die außereuropäische und antik-melodische mit der modernen europäischen, seit dem 16. Jahrhundert das bürgerliche Musikempfinden bestimmenden akkordharmonischen Ratio kontrastiert wird. Jener schreibt Weber eine willkürliche Artenvielfalt, dieser eine einzigartige Stringenz und Berechenbarkeit zu. Der Preis dieser modernen europäischen Ratio ist hoch: tonsystematische Konformität und Abstumpfung des melodischen Gehörs. Im modernen musikalischen 'bürgerlichen Möbel', dem Klavier, manifestiert sich diese europäische Ratio. In den Rationalisierungsanalysen offenbart sich dem 'Musiksoziologen' Weber künstlerisch-musikalisches Schaffen als Kampf der individuell schöpferischen Seele mit dem rationalisierten Ton-Material und den technisch-instrumentellen Ausdrucksmitteln. Die Musik-Studie wird hier erstmals im musik- und kulturwissenschaftlichen Kontext ihrer Entstehungszeit vorgestellt und mit ausführlichen Verzeichnissen sowie einem detaillierten Glossar einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht.
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Das Feld der Musiksoziologie ist nach wie vor ein Stiefkind der Wissenschaft und hat nach Wissen Andreas Dorschels im deutschsprachigen Raum auch nur zwei Schlüsseltexte hervorgebracht, nämlich Theodor W. Adornos "Einleitung in die Musiksoziologie" und eben Max Webers "Zur Musiksoziologie", ein Text der unter der Redaktion von Theodor Kroyer und der Witwe Webers 1921 herausgegeben wurde. Dabei hätten die beiden Abhandlungen bemerkenswerter Weise sowohl im "Inhalt" als auch in der "Methode" so gut wie keinen gemeinsamen Nenner, stellt der Rezensent fest, der betont, dass Webers Studie den größeren Grad an "Abstraktion" aufweist. Weber geht es darum nachzuweisen, dass das europäische Tonsystem mit seinen mathematisch berechneten Intervallen keineswegs das "natürliche in konsequentester Gestalt" ist, sondern lediglich die "spezifisch abendländische Gestalt von Vernunft" und das Ergebnis "historisch gefallener ästhetischer Entscheidungen", erklärt Dorschel. Er zeigt sich beeindruckt davon, wie "bemerkenswert frei von kulturchauvinistischem Dünkel" sich der Soziologe im Vergleich zwischen europäischen und anderen Tonsystemen zeigt und meint, dass es sich bei dem Untersuchungsgegenstand um eine "faszinierende und bis heute nicht ausgeschöpfte Fragestellung" handelt. Sehr lobt er auch Einleitung und "exzellenten Kommentar" zu der Abhandlung, die innerhalb der Gesamtausgabe von Max Webers Werken erscheint.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH