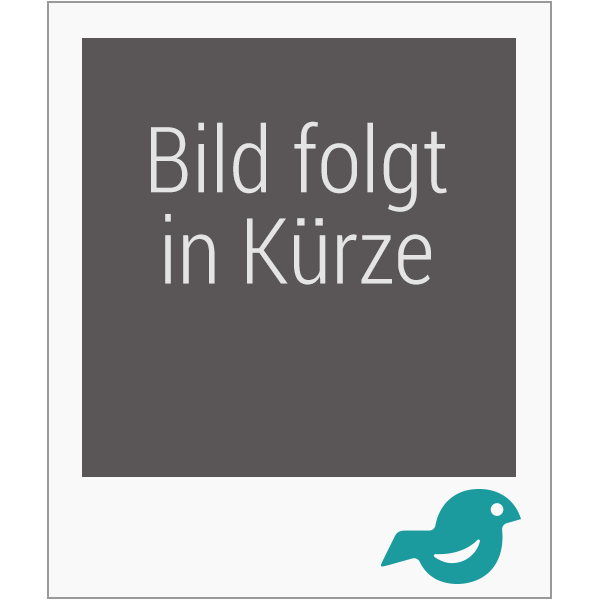"Wenn Lea also genug Kleingeld beisammen hatte, ging sie auf den Markt. Sie lief ein bisschen zwischen den Reihen hin und her und kaufte dann meist duftende rote Walderdbeeren mit grünen Schwänzchen. Die Marktfrau reichte ihr die Beeren in einer Tüte aus Zeitungspapier." Lea, die Chronistin von Melonenschale, ist bereits sieben Jahre alt und es hat sie und ihre Familie nach Moskau verschlagen, nein eigentlich in den Vorort Woskressensk, wo sie in einer staubigen Siedlung untergekommen sind und Lea sich erstmal als "Emigrantin" fühlt. Angefangen hat ihre Geschichte im menschenüberfüllten, farbenprächtigen aserbaidschanischen Baku, wo sie als Tochter ihrer jüdischen Mutter Selda Perlschtein und ihres armenischen Vaters Akop Tschachmachtschew auf die Welt kam. Die Kriegsjahre werden sie nach Baschkirien, dann nach Stalingrad führen. Später wird sie viele Jahre in Prag verbringen, von dort mit ihrer Familie als politische Emigrantin nach Hamburg gelangen - zurückbleiben mußte auf dieser letzten Etappe das alte Klavier, ein Familienheiligtum, das immerhin bereits die Wirren der Oktoberrevolution überstanden hatte. "Dann flüchteten sie aus Prag und waren überzeugt, daß sie niemals wieder zurückkehren könnten. Schimon wurde wegen Republikflucht verurteilt, und all ihre Sachen wurden beschlagnahmt, das Klavier natürlich auch. Indem sie sich selbst retteten, ließen sie es im Stich. Wo es jetzt steht und bei wem, ist unbekannt." Der Stoff von Melonenschale ist offen autobiographisch - Lea ein literarisches Alter Ego der Autorin Rada Biller, die über all die Jahre hinweg in geschliffenen literarischen Impressionen ihre Erfahrungen festgehalten hat. Aus den vielfältigen Mosaiksteinen hat sie behutsam den Roman eines Lebens zusammengesetzt, dessen Leitmotiv Verlust und Neubeginn darstellen.

Historische Nonchalance: Rada Biller macht ihr Leben zum Roman
Die Quintessenz steht auf der Rückseite des Schutzumschlages, kurz und bündig in der Werbung des Verlages. "Mit leichter Hand", heißt es dort, "zeichnet Rada Biller das Bild einer kulturellen und politischen Epoche." Übertrieben ist das nicht. Der Leser bekommt, was ihm versprochen wird, einen "anmutigen, melancholischen Roman", gefällige Unterhaltung vom Anfang bis zum Ende. Freundlich angerührt kann er der Lebensgeschichte Lea Tschachmachtschews folgen. Aus dem südlich bunten Baku führt ihr Weg über das quirlige Moskau, durch das dörfliche Baschkirien ins zerstörte Stalingrad, dann nochmals nach Baku, wieder nach Moskau und endlich weg aus der Sowjetunion durch den Prager Frühling nach Hamburg.
Von den dreißiger Jahren des vorigen Jahrhunderts bis in die Gegenwart spannt sich der Bogen; von der Kindheit und Jugend seiner Heldin vor allem handelt der "autobiographische Roman". Lea ist ein aufgewecktes Mädchen, beherzt und pfiffig wie Pippi Langstrumpf und zugleich so hilfsbereit wie eine gute Komsomolzin. Wenn Mama auf der Arbeit ist, putzt und kocht sie; abends gleitet die kleine Familie in den heiteren Feierabend, am liebsten gemeinsam mit Freunden und Bekannten. Die andere Seite der Geschichte, der Schrecken des Stalinismus, bleibt nicht nur für das Kind unfaßbar, auch dem Leser wird diese Beklemmung weitgehend erspart. Noch als der Vater, der Nachkomme eines "Kapitalisten", die Familie verlassen muß, um Denunziation und drohender Verhaftung durch die Kommunisten zu entgehen, findet der Roman schnell zurück in die familiäre Geborgenheit. Mit ihrer Ausgestaltung verliert sich der irritierende Eindruck historischer Authentizität, wann immer die Zeitläufte verstörend erkennbar werden.
Nicht, daß hier etwas verfälscht wäre, daß es einen Grund gäbe, an der Wahrheit des Geschehens zu zweifeln; ganz fraglos ist der Roman biographisch verbürgt. Hinter Lea, von der sie in der dritten Person erzählt, steht Rada Biller selbst. Wie ihre Figur stammt die Autorin aus einer bürgerlichen Familie. Aus dem tiefen Süden der Sowjetunion hat es sie nach Moskau verschlagen, umgetrieben vom Stalinismus und von den Wirren des Krieges. Später, in den Jahren der Lockerung, durfte sie mit ihrem tschechischen Mann nach Prag übersiedeln, von wo die Familie dann 1970 weiter in den Westen fliehen mußte. Für dreißig Jahre wurde Hamburg zur neuen Heimat. Und es ist wohl diese letzte Phase, das anverwandelte Weltbild des Westens, das den eigentümlichen Charakter ihres Buches erklären mag. Diesen Vorstellungen soll die Darstellung genügen. Gleich, ob der Markt in Baku in mediterranen Farben leuchtet, eine sowjetische Siedlung zum "Krähwinkel" wird oder ob es von einem Mann aus dem Odessa der dreißiger Jahre heißt, daß er "aussah wie Sammy Davis junior" - derartig schiefe Vergleiche sind verräterische Stilfehler, weil sie das Bild der Vergangenheit nach den Erwartungen der Gegenwart einfärben, so daß es sich mit dem Lifestyle verträgt.
Alles scheint da im nachhinein möglich. "Im Winter", erfahren wir beispielsweise auf Seite 104, "fuhren die gesamten Kinder auf dem Hügel Ski oder Schlitten." Und das weit hinten in Baschkirien schon vor dem Zweiten Weltkrieg, zu einer Zeit also, in denen an das heute so beliebte Skifahren als Volkssport überhaupt noch nicht zu denken war.
Was Rada Biller mit dieser historischen Nonchalance geschaffen hat, ist ein Mosaik aus Erinnerungsfetzen, verwischt durch den Zeitgeist der Spaßgesellschaft. Um sie nicht zu enttäuschen, um sie nicht mit dem Bösen zu verstören, wurde die Biographie melancholisch verfremdet. Noch die dunkleren Felder sind da mit einem matten Glanz überzogen. Von der "Rattenmama", dem "Papa" und den "Rattenkindern" ist die Rede, als beschrieben wird, wie das Ungeziefer nachts in die Betten kommt, mitten im Krieg im zerstörten Stalingrad. Bereits die Reise dahin, eine Flußfahrt auf der Wolga, liest sich, als sei sie nach dem Muster des "Titanic"-Films geschrieben: Luxus und schöne Kleider auf dem Oberdeck, mit großen Augen beobachtet von dem Mädchen, das sich heimlich von unten hinaufstiehlt. Aus ihren Träumen ist dieses Buch entstanden, ein westliches Rußlandbild, in das sich auch Omar Sharif noch als Doktor Schiwago einfügen könnte.
THOMAS RIETZSCHEL
Rada Biller: "Melonenschale". Autobiographischer Roman. Aus dem Russischen übersetzt von Antje Leetz. Berlin Verlag, Berlin 2003. 373 S., geb., 22,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main