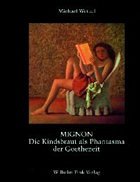"Hier ist das Rätsel!" Mit diesen Worten wird in Goethes epochemachendem Bildungsroman Wilhelm Meisters Lehrjahre die Figur der Mignon eingeführt, ein schätzungsweise zwölfjähriges Mädchen, dessen Geschichte und Auftreten allen Vorstellungen von weiblicher Erziehung der beginnenden bürgerlichen Ordnung zu widersprechen scheint. Elternlos mit einer Gauklergesellschaft herumziehend, verweigert sie sich selbst ihrer geschlechtlichen Zuordnung und beharrt darauf, ein Knabe zu sein.
Und dennoch wird diese enigmatische Außenseitererscheinung, der auch ein Eigenname zugunsten des Allgemeinbegriffs "mignon" ("lieblich/süß" oder - im Sinne der höfischen Tradition - "Lustknabe") verweigert bleibt, zum geheimen Zentrum aller Geheimnisse von Bildung und Entwicklung in Goethes Roman: wie das Reif- oder Erwachsenwerden, das Verhältnis von Schicksal und Charakter, die Entscheidung geschlechtlicher Identität oder die Metamorphose des kindlichen Körpers.
Und dennoch wird diese enigmatische Außenseitererscheinung, der auch ein Eigenname zugunsten des Allgemeinbegriffs "mignon" ("lieblich/süß" oder - im Sinne der höfischen Tradition - "Lustknabe") verweigert bleibt, zum geheimen Zentrum aller Geheimnisse von Bildung und Entwicklung in Goethes Roman: wie das Reif- oder Erwachsenwerden, das Verhältnis von Schicksal und Charakter, die Entscheidung geschlechtlicher Identität oder die Metamorphose des kindlichen Körpers.

Michael Wetzel weiß mehr über Mignon, als der Leser wissen will
Den Schlager, den Maurice Chevalier im Film "Gigi" zum Besten gab - "Thank Heaven For Little Girls" -, könnte vermutlich ein genügend durchtheoretisiertes Gehirn als die sentimentale Kehrseite einer Kinderpornografie dekonstruieren, die von den verheimlichten Zeichnungen des neunzehnten Jahrhunderts bis zum Internet alle Gelüste der Nympholeptiker befriedigt hat. Die wissenschaftliche Wiederentdeckung der Kindheit um 1950 durch Erik Erikson und Philippe Ariès zusammen mit deren politischer Radikalisierung durch Foucault und die französischen Freudianer hat nun auch die Literaturwissenschaft auf solche Phänomene wie "das onanierende Mädchen bei Jane Austen" aufmerksam gemacht. So verwundert es nicht, dass ein Verfasser, der sich bereits mit der "fotogenen Entblößung des Blicks bei Lewis Carroll" und mit dem "Denken nach Jacques Derrida" hervorgetan hat, sich von diesem brisanten Thema stark angezogen fühlte.
Zwar lässt sich die Idealisierung der Mädchengestalt seit Dante und Petrarca wiederholt feststellen. Wetzel meint aber, dass erst im bürgerlichen Zeitalter dieses Bild sich in dem Maße erotisiert habe, dass die von Arno Schmidt übernommene Bezeichnung "Kindsbraut" gerechtfertigt sei. Es ist seine Überzeugung, dass ihre Kombination von Naivität und Erotik in Wirklichkeit nichts als Wunschtraum oder "Phantasma" sei - eine Projizierung des männlichen Begehrens auf die idolisierte Gestalt des Mädchens im Übergangsstadium der Pubertät, das zuerst Rousseau im Unterschied zur Kindheit und Jugend definiert habe.
Auf seiner Suche nach den Beweggründen dieser Männerfantasie identifiziert Wetzel drei Hauptmotive. Der "Regressionsthese" gemäß sei die Kindsbraut das Symptom einer Wiederbelebung infantiler Liebesbeziehungen. Der "Spaltungsthese" entsprechend, erkenne dieser regressierte Außenseiter neben der Frau als Mutter oder femme fatale zugleich eine femme fragile/infantile - eine Doppeldeutigkeit, die einerseits in den antiken Mythen der Androgynität beziehungsweise des göttlichen Mädchens zu erblicken sei und andererseits in dem Bild des Phallus-Mädchens, dessen anorektischer Körper dem männlichen Glied ähnele. Nach der "Geschlechtsdiffusionsthese" bringe schließlich die Männerfantasie das onanierende Monster-Mädchen hervor, auf das der betrachtende Mann mit ablehnender Misogynie reagiert.
Der psychoanalytischen Analyse der Männerfantasien, die Foucault und Lacan tief verpflichtet ist, folgt eine Darstellung der historischen Faktoren, die zur Gestaltung von Goethes Mignon als "Muse der Pubertät" beigetragen haben sollen - einer Figur, die nicht so sehr eine Person als einen Motivkomplex darstelle, "das Programm des erotischen Ideals moderner bürgerlicher Subjektivität". Als Beispiele für den "pädagogischen Eros", der durch alle drei Motive der Männerfantasie getrieben wird, werden zunächst das Verhältnis zwischen Lichtenberg und seiner Adoptivtochter Maria Stechard und die Erziehungsstrategien von Rousseaus Emile erörtert.
In "Wilhelm Meisters Lehrjahre" gesellen sich zum pädagogischen Motiv auch noch das biologische, wonach Mignon botanisch nach Art der Urpflanze sich durch alle Stadien des Wachstums bis zur Petrifizierung entwickelt, und das ästhetische, wobei Elemente vom Pygmalion-Thema, von Watteaus Pierrot und von den damals populären tableaux vivants zur Gestaltung ihres Ikons beitragen. Hierbei verweist Wetzel auf die vielen Zwillingsgestalten der zeitgenössischen Malerei, um die Komplementärität der Figuren Mignons und Philenes überzeugend zu beleuchten.
Das charakteristische Schweigen der präromantischen Muse Mignon wird als das Schweigen interpretiert, das den Eingeweihten von Eleusis auferlegt wurde; ihr Tod erscheint damit als Initiation. Mit Hinweis auf die geflügelten Phalloi aus Goethes eigener Sammlung gebe sich das tote Kind in seinen Engelkleidern als Phallus-Mädchen zu erkennen. Das Element des Pathologischen, das bei Mignon immer wieder auftaucht, wird durch Goethes Interesse für die zeitgenössischen medizinischen Theorien erklärt (C.W. Hufeland, J.G. Zimmermann). So begreifen wir Mignons Ätiologie letzten Endes als "Befriedigung eines tiefen Interesses an der Vermessung von Devianz".
Gilt Mignon als "Schutzheilige des Weimarer Literaturkartells", so wird sie von den Romantikern zur poetischen Göttin verklärt; ihre Gestalt findet Parallelen in den Kindsbräuten bei Novalis und E.T.A. Hoffmann. Aber die romantische Regression manifestiert sich weniger in den Dichtungen als in den Liebesaffären der Dichter. Goethes Begegnungen mit Minna Herzlieb und Bettine Brentano werden als Beispiele gelebter Nachahmung von Kunst gelesen. In Bettinens berühmtem Entwurf für das Goethe-Denkmal stelle sie sich selbst in der Gestalt der nackten Psyche dar, die zwischen des Dichters Knien steht, als Phallus-Mädchen. Während Wetzel überzeugende Parallelen zwischen Mignon und ihrer "romantischen Schwester" Violette in Brentanos Roman "Godwi" aufdeckt, lassen sich die regressiven Elemente vor allem in Brentanos Verhältnis zu Sophie Mereau, Auguste Bußmann und den anderen Frauen in seinem Leben erblicken.
Das Werk endet mit einem kurzen Ausblick auf die zunehmende Säkularisation der Kindsbraut in der Literatur des neunzehnten Jahrhunderts - zu Außenseiterinnen, zu Kinderprostituierten und zu Ikonen der Puppenproduktion.
Hinter den 466 dicht bedruckten Seiten dieser hochintelligenten und oft brillanten Habilitationsschrift liegt eine kluge und lesbare Monografie von etwa 300 Seiten verborgen. Wetzel hat Philosophie, Juristerei, Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert mit heißem Bemühn - und nichts vergessen oder gestrichen oder ausgespart. Das führt manchmal zu faszinierenden Ergebnissen, wie etwa bei den Ausführungen zu pädagogischen und medizinischen Theorien oder zum mythologischen Denken des achtzehnten Jahrhunderts. Andererseits wird des Lesers Aufmerksamkeit immer wieder durch ausführliche Anmerkungen oder ganze Seiten abgelenkt, die gerade das dokumentieren, was nicht behauptet wird. Das oft irrelevante Spiel mit etymologischen Assoziationen wird manchmal zu weit getrieben, wenn etwa Mignons "genug" durch die Verbindung vom lateinischen satis mit Satire eine weitere Dimension abgewonnen werden soll. Weil jeder Behauptung dasselbe Gewicht verliehen wird - dem allgemein Bekannten sowie dem Esoterischen -, weiß man am Ende nicht, ob Mignon als Phallus, als onanierendes Monster-Mädchen, als Braut Christi oder etwa als Dürer'scher Engel der Melancholie verstanden wird: Ihre Eigenheit verschwindet hinter der Anhäufung von Rollen, die sie angeblich spielt. Nützt es wirklich unserem historischen Verständnis, wenn Clemens Brentano als "der Michael Jackson der Romantik" bezeichnet wird und seine Schwester Bettine als eine Vorläuferin von Tina Turner und der heutigen Popkultur?
Wetzel lässt alle Glocken der Theorie läuten, aber beim Gebimmel überhören wir oft gerade die thematische Melodie des Werkes und die harmonischen Zusammenhänge. Allzu oft wird zum Beweis aus theoretischen Werken zitiert, wo man Fakten oder Primärtexte erwartet. Irritierend ist es auch, dass viele Illustrationen ohne Hinweis oder Erklärung angeführt sind.
Der Verfasser gesteht, dass seine ursprünglich diachronisch konzipierte Arbeit schließlich zu Gunsten der "epochalen Dichte der Synchronie" geopfert wurde. Dabei hätte er auf die psychoanalytische Erörterung der Männerfantasien verzichten können sowie auf die skizzenhaften Kapitel über Novalis, E.T.A. Hoffmann und das neunzehnte Jahrhundert. Beim Lesen dieses überlangen Buches mit seiner hypertheoretisierten Sprache möchte der Leser oft mit Mignon ausrufen: "Genug!" Immerhin werden wir Maurice Chevalier kaum noch mit unschuldigen Ohren lauschen können.
THEODORE ZIOLKOWSKI
Michael Wetzel: "Mignon. Die Kindsbraut als Phantasma der Goethezeit". Wilhelm Fink Verlag, München 1999. 503 S., Abb., br., 78,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
Kenntnisreich entfaltet Rezensentin Silvia Henke Wetzels "groß angelegte Studie" zum Phantasma der Kindsbraut, das er in seinen mythischen wie literarischen Ausgestaltungen von den Nymphen der Antike bis zu den Models von heute verfolgt. Die Kindsbraut, zwischen Kind und Frau, zwischen Mädchen und Knabe changierend, begreift er als Männerphantasie, "die um die Reife, Kindheit und Geschlechterdifferenz kreist und dabei die wirkliche Frau, unter Umständen, verfehlt". Kernstück von Wetzels Studie ist Mignon aus Geothes "Wilhelm Meister", die er als Archetypus ihrer Spezies begreift. Was Wetzels Arbeit interessant macht, schreibt Henke, ist die "Verbindung von Poesie und Pathologie". Es ist überhaupt ein Verdienst dieser Arbeit, "Problemfelder eher zu öffnen als zu schließen", resümiert die Rezensentin, die in ihrer Besprechung ähnlich verfährt.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH