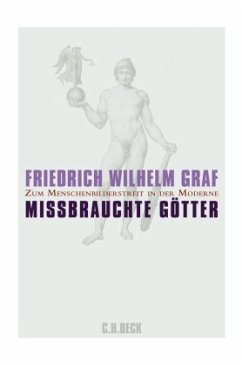Luzides Essay
Der systematische Theologe Friedrich Wilhelm Graf (ev. Theologie, Ludwig-Maximlians-Universität, München) verlässt sein akademisches Feld und äußert sich in einem umfangreichen Essay pointiert zur Diskussion um Menschen- und Gottesbilder. Der Leibnizpreisträger will als
Religionsintellektueller „Glaubensanalyse“ (S. 13) betreiben und erhofft sich ein „besseres Verständnis der…mehrLuzides Essay
Der systematische Theologe Friedrich Wilhelm Graf (ev. Theologie, Ludwig-Maximlians-Universität, München) verlässt sein akademisches Feld und äußert sich in einem umfangreichen Essay pointiert zur Diskussion um Menschen- und Gottesbilder. Der Leibnizpreisträger will als Religionsintellektueller „Glaubensanalyse“ (S. 13) betreiben und erhofft sich ein „besseres Verständnis der religionskulturellen Entwicklungen in der Moderne seit 1800 und speziell der wenig übersichtlichen religiösen Lage der Gegenwart“ (S. 13). Nach einem einleitenden Kapitel („Sehepunkte“) gelangt Graf in drei Schritten („Gottesbilder“, „Ebenbilder“ und „Menschenbilder“) zu seinem Schlusskapitel, welches den schönen Neologismus „Gottesgnadenwürde“ als Titel trägt. Darin kritisiert der scharfzüngige Wortartist unter anderem, dass „die Menschenwürde“, welche von Kirchenvertretern beider großen Konfessionen gerne auf die jüdisch-christliche Tradition zurückgeführt werde, tatsächlich aber von der ev. und die kath. Kirche Deutschlands „erst entdeckt [wurde], als sie im Rechtssystem der Bundesrepublik bereits zur 'Grundnorm' avanciert war“ (S. 199). Trotz seiner kritischen Grundhaltung gegenüber dem Agieren ausgebildeter Theologen rundet Graf sein überwiegend diagnostisches Essay in theologisch-apodiktischer Form ab. So gießt er er die Verhältnisbestimmung der Konzepte Menschenbild, Gottesbild, Bilderverbot und Menschenwürde in folgende Worte: „Mit dem Bilderverbot schützt Gott sich vor unserer Bemächtigung. Und die Unantastbarkeit unserer Würde haben wir nicht selbst erarbeitet, sondern sie ist vom unantastbaren Gott garantiert“ (S. 202). Während ihn hier dogmatische Unbedingtheit zum theologischen Werbetexter werden lässt, schießt er an anderen Stellen um der Pointe Willen über das Ziel hinaus: So vernebelt bei dem von Graf mehrfach verwendeten Begriff „Milieutheologie“ die wertende Konnotation den beschriebenen Gegenstand (vgl. z.B. S. 80); auch Bilderunterschriften wie „Amerikanische Truppen sind gern Ikonoklasten“ (S. 89) bedienen eher Klischees als dass durch sie soziale Zusammenhänge erhellt werden. So ist zu bedauern, dass Graf für dieses elementar wichtige Thema eine Textform gewählt hat, bei welcher er die Kriterien streng wissenschaftlicher Methodik vernachlässigen kann.
Wer also Friedrich Wilhelm Grafs pointiert formulierte Artikel aus FAZ, SZ oder NZZ kennt und schätzt, kann sich freuen, da er nun einen luziden journalistischen Text im theologischen Terrain in den Händen hält, dessen schiere Länge die Dimensionen des Feuilletons einer Tageszeitung sprengen würde.